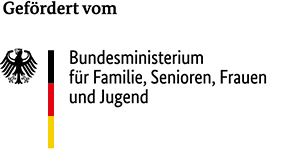Alexandr Dugin
Dugin

Martin Heidegger
Heidegger

Sigrid Hunke
Hunke

Ernst Jünger
Jünger

Konrad Lorenz
Lorenz

Thomas Mann
Mann

Arthur Moeller
van den Bruck
van den Bruck

Armin Mohler
Mohler

Arnold Gehlen
Gehlen

Ernst Niekisch
Niekisch

Sayyid Qutb
Qutb

Richard Wagner
Wagner

Carl Schmitt
Schmitt

Oswald Spengler
Spengler

Botho Strauß
Strauß

Alain de Benoist
de Benoist











![[Podcast] Corona-Proteste: Eine Gefahr für die Demokratie?](https://gegneranalyse.de/wp-content/uploads/podcast_beitrag-1200x800.jpg)