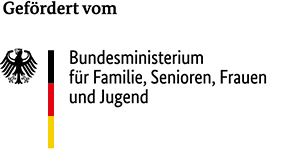Steinzeitislam? Die Taliban als neuzeitliches Phänomen

Die Taliban sind eine typisch neuzeitliche, puritanische Erweckungsbewegung, sagt der Islamwissenschaftler Prof. Dr. Reinhard Schulze von der Universität Bern. Mit Mittelalter oder Tradition habe das weniger zu tun. Vielmehr entstammten sie einer Gegenbewegung, die auf gesellschaftliche Säkularisierungsprozesse in Südasien reagierte. Die Taliban hätten zudem ein massives Legitimationsproblem und drohten, an sich selbst zu scheitern.
Gegneranalyse: Die Machtübernahme der Taliban wurde als Rückkehr des Steinzeitislam bezeichnet. Sie hingegen beschreiben die Taliban als Anhänger einer „neuzeitlichen puritanischen Orthodoxie“. Was ist so neuzeitlich an den Taliban?
Prof. Dr. Reinhard Schulze: Da wäre zuerst der historische Aspekt: Die in Indien entstandene Deoband-Tradition und ihre Vorläufer, auf die sich die Taliban berufen, gehen auf das 18. und 19. Jahrhunderts zurück. Das ist zweifellos der Zeitraum, den wir als neuzeitlich deuten und interpretieren würden.
Der zweite Aspekt betrifft die Qualität, also was als neuzeitlich im Unterschied zu mittelalterlich oder gar antik gelten kann. Sie zeigt sich nicht nur auf konzeptueller Ebene, die christliche Orthodoxien mit denen des Islam in dieser Zeit verbindet, sondern auch in den Parallelen zu ähnlichen Erweckungsbewegungen etwa in Amerika oder in England in der Zeit des Great Awakening.
Das heißt, im Kontext der Neuzeit entstehen in Europa und Amerika aber auch im Nahen Osten und in Ländern wie Indien solche Erweckungsbewegungen, die spezifisch auf die neuzeitlichen Bedingungen reagierten und nicht etwa auf antike oder mittelalterliche Traditionen.
Gegneranalyse: Und da würden Sie auch den Wahhabismus einordnen?
Schulze: Unbedingt, den Wahhabismus sogar noch viel deutlicher als die Tradition indisch-muslimischer Puritaner, die sich dann später in der sogenannten Deoband-Tradition zusammengeschlossen haben. Das allein schon deshalb, weil der Gründungsvater des Wahhabismus, Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhāb, genau dieselben Lebenszeiten hat, wie John Wesley, der Begründer der Methodisten in Amerika: 1703 bis 1791. Wir haben hier nicht nur eine biografische Parallele, sondern auch eine gewisse inhaltliche, was die Missionsaspekte, die spirituelle Haltung und einen Sittenkodex anbetrifft. Wir haben es offensichtlich in der Neuzeit mit einer Transformation des Religiösen zu tun, und zwar im Kontext einer Gesellschaft, die sich sehr stark in die Richtung, in der wir heute leben, veränderte.
Gegneranalyse: Geht es um die Säkularisierung?
Schulze: Das sind Säkularisierungsprozesse, die aber nicht so programmatisch abgelaufen sind, wie wir das aus Europa mit dem Aufkommen der Aufklärung und Ähnlichem kennen. Die Säkularisierung vollzog sind in vielen Teilen der muslimischen Welt eher als Prozess sozialer Differenzierung, indem sowohl in den Lebenswelten wie in den Vorstellungswelten zwischen weltlicher und religiöser Sphäre fundamental unterschieden wurde. Das heißt, man erkannte die Autonomie der Welt und der Gesellschaft gegenüber der Autonomie der Religion an. Das ist seit dem 16./17. Jahrhundert, also in der Neuzeit, ein weltumspannender Prozess gewesen. Und dieser neuzeitliche Prozess hat dann eine Art von Gegenneuzeit provoziert. Diese Gegenneuzeit behauptete genau die Aufhebung dieser Differenz. Dies ist der Kern des Puritanismus. Wenn die Puritaner sagten, dass diese Differenz keine Gültigkeit habe, zeigt dies, dass es sehr viele Leute und Gruppen gegeben hat, die für die diese Differenz von Religion und Welt die Lebensordnung darstellte.
Gegneranalyse: Muss man sich also auch die muslimische Welt im 18. Jahrhundert so vorstellen, dass es damals für große Teile der Gesellschaft eine Trennung zwischen weltlicher und religiöser Sphäre gab?
Schulze: Dafür gibt es sehr viele Hinweise. Die Rollenverteilung von Religion und weltlicher Herrschaftsordnung war ziemlich klar definiert. Man findet sie in verschiedener Hinsicht abgebildet, etwa durch die Unterscheidung von religiösem und weltlichem Wissen in der Öffentlichkeit, durch die Unterscheidung von Herrschaftsrecht und religiöser Rechtsüberlieferung und durch die Rechtsordnung insgesamt. Ein Indikator dafür ist, dass Gruppen wie die Wahhabiten oder die Ahl‑i Hadith, die „Traditionalisten“, die Ahnen der späteren Deobandis und dann der Talibani, im Grunde auf diese Differenz reagierten. Das heißt also, ihre Interpretation des Islam, ihre puritanische Orthodoxie ist kein Wiederbeleben einer alten Tradition, sondern die Reaktion auf neuzeitliche Interpretationen und Zuordnungen des Religiösen.
Gegneranalyse: Ist die von den Puritanern propagierte Rückkehr zu den Ursprüngen also eine imaginierte Vergangenheit, die es so nie gegeben hat?
Schulze: Sie würden nie mit dem Begriff der Vergangenheit operieren, sondern immer mit dem Abstraktum Islam oder göttliche Ordnung und sagen: Wir orientieren uns an dieser göttlichen Ordnung, wir haben sie durch unsere Erweckungsbewegung in unserer Tradition wiedergefunden. Es sei der eigentliche Auftrag des Menschen, in eben solch einer Ordnung zu leben. Die Vergangenheit gilt ihnen nur als Abirrung von dieser eigentlichen und ursprünglichen Ordnung. Und es sind diese Eigentlichkeit, diese Wesentlichkeit, diese Ursprünglichkeit, also diese Perspektive auf die Religion, die dem Puritanismus ein sehr neuzeitliches Gepräge geben. Hier ähneln sich islamische Puritaner und die englischen Puritaner im 17. Jahrhundert, die zum Namensgeber dieser Neuausrichtung der religiösen Welten wurden.
Gegneranalyse: Ist der qualitative Unterschied, dass es den Puritanern um Normenbefolgung und nicht länger um Auslegung religiöser Normen geht?
Schulze: Genau. Sie gründen ihre Normen nicht mehr auf einer Rechtsableitung. Stattdessen formulieren sie die Normen als Ergebnis einer strengen Kasuistik, in der festgelegt wird, dass aufgrund der Verallgemeinerung einer Aussage aus der Prophetentradition ein bestimmtes Gebot oder Verbot besteht. So hieß es bei den Taliban 1996, dass es fortan nicht mehr erlaubt sei, öffentlich Musik zu hören. Diese Norm wurde nicht aus einer anderen bestehenden Setzung abgeleitet, sondern als Erfüllung einer in einer Prophetentradition ausgedrückten Norm.
In der Kasuistik der Puritaner fallen moralische, sittliche Ordnung und rechtliche Ordnung zusammen. Die Trennung von Moral und Recht, die im alten klassischen islamischen Recht fundamental war, wird aufgehoben zugunsten einer normativen Aussage, in der das moralisch Gute mit dem Rechtsgültigem gleichgesetzt wird. Während in der klassischen Rechtsordnung es als rechtsgültig angesehen wird, wenn eine nichtmuslimische Amme ein muslimisches Kind stillte, meinen die Puritaner, dies sei nicht rechtmäßig, weil es unmoralisch sei. Diejenigen, die sich diese Moral zu eigen machen, sehen sich deshalb berufen, selbst die Exekutive dieser Moral zu sein. Das heißt, sie können sie formulieren und auch durchsetzen. Und wenn sie zum Beispiel beobachten, dass jemand im Café ein Bier trinkt, dann sehen sie sich unter Umständen legitimiert einzuschreiten und das Glas Bier umzustoßen.
Gegneranalyse: Das klingt sehr nach einer wörtlichen Auslegung religiöser Quellen. Aber da gibt es ja durchaus auch widersprüchliche Aussagen.
Schulze: Sie benutzen vor allem die Prophetentradition, aus der eine Vielzahl von einzelnen Handlungsvorbilder für das Individuum gewonnen werden. Es handelt sich um eine komplexe Sammlung mit insgesamt etwa 600.000 auf den Propheten bezogenen Einzelaussagen, die dann auf ihre Authentizität hin geprüft wurden, so dass noch etwa 6.000 oder 14.000 als autoritativ erachtete Traditionen verblieben. Sie bilden keine geschlossene Menge, so dass sich jeder theoretisch seine eigene Welt aus der Prophetentradition zusammenzimmern könnte, wie er oder sie es braucht. Von daher gibt es da keinen normativen Kanon, aber auch keine eindeutig islamisch rechtfertigte Ordnung. Die Traditionen können genauso gut genutzt werden, um Demokratie, Liberalismus und viele andere Ordnung durch einen moralischen Bezug auf die Prophetentradition zu rechtfertigen.
Gegneranalyse: Wie sind Fotos aus den 60er Jahren in Kabul zu bewerten, die unverschleierte Frauen in Parks in kürzeren Kleidern zeigen? War das Land damals auf dem Weg in die Moderne mit einem halbwegs demokratischen System und ist der Islamismus erst später gewachsen?
Schulze: Die Antwort hängt davon ab, was wir unter Moderne verstehen. Das spiegelt sich auch in unserer Vorstellungswelt wider, wenn wir Frauen, die im Park in Kabul herumgelaufen sind, mit moderner Kleidung sehen. Das ist unser Bild von Modernität, eine urbane, städtische Modernität. Das ist unsere Vorstellung von Stadt, und die Stadtkultur ist der Rahmen, in dem sich dann die Moderne entfaltet und vollziehen soll: Öffentlichkeit, Parks und alles was dazugehört. Aber das ist nur eine Form von Modernität.
Es gibt auch noch eine andere Form von Modernität, die eher in den Provinzstädten, auf dem Land, unter bestimmten sozialen Gemeinschaften und Gruppen möglich gewesen ist, die gar nicht diesen symbolischen Raum belegt haben, den sich diese Städter so gern zu eigen gemacht haben.
Der städtische urbane Raum war in Afghanistan immer recht klein. Er expandierte in den 60er Jahren aufgrund auch eines sozialen Wandels und des Bevölkerungswachstums. Die Städte wuchsen und durch die Landflucht bildeten sich neue suburbane Räume. Mit der Expansion der Städte entstand eine Vorstellung, dass diese urbane Modernität, der urbane Raum, repräsentativ sei für Afghanistan. Die Städter dachten sich Afghanistan wie eine große Stadt. Das war sicher die große Lüge, weil man immer nur die Perspektive der urbanen Handlungsträger eingenommen hat.
Die Städter sahen sich darüber hinaus als Repräsentanten der Nation und deuteten die Nation im Grunde als ein Abbild ihrer urbanen Lebenswelten. Da haben schon Ende der 60er Jahre diejenigen, die vom Land in die Stadt gekommen sind, nicht mithalten können. Weil ihnen der soziale Aufstieg versperrt war, haben sie versucht, Gegenwelten aufzubauen – zuerst aufgrund ihrer Herkunft. Dann haben sie sich von ihrer Herkunft gelöst, konnten aber doch nicht in die neueren Räume einsteigen. Dieses Scheitern meinten sie, mit Islam zu rechtfertigen. Es war ein Islam der städtischen Neusiedler, die nicht in die Privilegienordnung der Stadt aufsteigen konnten. Es bildeten sich erste islamischen Studiengruppen. Mitbegründer war zum Beispiel Burhanuddin Rabbani, der die Idee der Muslimbrüder in Kabul verbreiten wollte, und Gulbuddin Hekmatyar, der später die äußerst militante „Islamische Gemeinschaft“ anführen sollte.
Diese Islamisten haben genauso eine Modernität vertreten, aber es handelte sich eben um eine islamisch ausformulierte Modernität. Und über diese Form von urbanem Lebensraum und urbaner Lebensinterpretation kamen dann immer mehr islamische Themen und vor allem paschtunische Themen in die Debatte rein.
In den 70er Jahren erleben wir dann, wie der urbane Raum einen expliziten Machtanspruch über das Land erhebt, indem er sich zur Republik erklärte. Der afghanische König stammte theoretisch noch vom Land. Er war ein Durrani, der vom Land gekommen ist, und der die Gesamtheit, also die Nation als Einheit von Stadt und Land repräsentierte. Doch wurde er 1973 von seinem Vetter Mohammed Daoud Khan gestürzt, der die Republik ausrief. Er formulierte damit den Anspruch, dass jetzt die Stadt über das Land herrscht. Es folgte die Revolte des Landes. Mit der Revolution von 1978, durch den der Staat ideologisch als „sozialistisch“ begründet wurde, radikalisierte sich der Konflikt.
In den 70er Jahren bildeten sich die ersten Formationen, die das Land als Gegenwelt zur Republik der Stadt mobilisierte. Das war zunächst von den einzelnen Ethnien zwar unabhängig, doch bildete sich der Widerstand vor allem im paschtunischen Milieu. Und daraus baute sich ein Antiurbanismus auf, der sich in den 70er Jahren immer mehr islamisiert, weil der Islam als Vorstellungsraum den ländlichen Raum am besten zu repräsentieren schien, als Gegenwelt zu den säkularen Städtern, die ihnen als Apostaten – vom Glauben Abgefallene – gelten.
Gegneranalyse: Ist der Begriff „Stammesgesellschaft“ hierbei hilfreich?
Schulze: Jein. Es gibt zwar etwas wie ein „stammliches Bewusstsein“, das heute in der Öffentlichkeit dominiert. Aber das ist kein ursprünglicher Zustand der islamischen Gesellschaft, sondern ein Prozess, der sich im 19. und 20. Jahrhundert entfaltet hat. Es haben sich immer größere Verwandtschaftsbünde herauskristallisiert, die dann zu einer Kollektividentität namens Paschtunen, Tadschiken, Usbeken usw. geführt haben. Was wir heute als Stammesgesellschaften deuten, ist eigentlich ein Produkt einer Sozialgeschichte der Moderne.
Gegneranalyse: Gibt es eine Tendenz in dem Gegensatz zwischen Stadt und Land?
Schulze: In den letzten zehn Jahren hat der urbane Raum deutlich an Bedeutung gewonnen. Der soziale Wandel war so stark, dass er eine Aufwertung des urbanen Raums ermöglichte. Man sieht das an der Zunahme der Frauen in Beschäftigungsverhältnissen. Vor zehn Jahren waren sie bei ungefähr zwölf Prozent, heute sind 22 Prozent in ganz Afghanistan beruflich aktiv. Das deutet darauf hin, dass der urbane Raum expandierte.
Weil mit dieser Expansion die Entwicklung des Landes vernachlässigt wurde, hat sich die Antipathie des Landes gegen die Stadt verstärkt. Der Siegeszug der Taliban in Kabul, in Dschalalabad und anderen Städten ist eher auf das Konto derjenigen zu buchen, die vom Land gekommen sind. Die Haqqani-Truppe der Taliban ist so eine typische Landtruppe, während die andere Gruppe, die Kandahar-Gruppe, noch der Nobilität angehört, die unter den Paschtunen eine Rolle spielt.
Gegneranalyse: Können Sie den Begriff „Nobilität“ erklären?
Schulze: Die paschtunische Gesellschaft, die heute existierende Stammesgesellschaft, ordnet sich nach sozialem Prestige. Je nachdem wie tief die Genealogien reichen, haben sie eine höhere Stellung in der Gesellschaft. Und ganz oben stehen seit dem 18. Jahrhundert die Durrani. Sie haben das Königshaus gestellt, sie stellten mit Karsai und anderen immer die Chefs der Regierung. Das waren die halb verstädterten Leute vom Land. „Adel“ wäre eine, wenn auch schlechte Übersetzung dafür, was im Paschtu als Nobilität bezeichnet wird. Jetzt gibt es einen Konflikt zwischen den Taliban, die vom Land kommen, und denen, die sich eher auf die Durrani-Abstammung beziehen.
Gegneranalyse: Konnten die Taliban die Macht so schnell ergreifen, weil sie das repräsentieren, was die Afghanen eigentlich gerne wollen?
Schulze: Überhaupt nicht. Ihre Legitimationsbehauptung beruhte darauf, dass ihre puritanische Orthodoxie die alten Sittenordnungen, die die Stämme für sich in Anspruch nahmen und die maßgeblich ihre Kollektividee bestimmten, wiederherzustellen und zu sichern schien. Diese Sittenordnungen oder Sittengesetze waren durch die langen Kriegsjahre so zerrüttet, dass sie den sozialen Zusammenhang nicht mehr garantieren konnten. Der Islam der Taliban versprach hier eine Restauration der alten Ordnung, doch für viele Gemeinschaften erwies sich dies als eine trügerische Hoffnung. Die Taliban aber brauchen notwendig die Zustimmung zu ihrem islamischen Projekt.
Gegneranalyse: Sie haben eher ein Legitimationsproblem?
Schulze: Sie haben ein riesiges Legitimationsproblem und daran werden sie vermutlich auch scheitern.
Gegneranalyse: Das Taliban-Emirat hat eine ganze Reihe von Gegnern innerhalb Afghanistans. Ist damit zu rechnen, dass sie sich lange an der Macht halten können?
Schulze: Dafür müssten sie eine Politik entwickeln, die geeignet ist, im Land selbst hinreichend Legitimität zu schaffen. Jetzt verlagern sie das Legitimitätsproblem nach außen, in dem sie sagen, Länder wie Usbekistan, China, Indonesien, Türkei, Iran erkennen die Regierung in Kabul an. Und irgendwann, so sagen sich viele Taliban-Führer, entsteht hierdurch von außen hinreichend Legitimität für die politische Führung in Kabul, so dass das Volk allein deshalb schon gehorsam wird, weil genügend auswärtige Legitimität existiert. So ihre Idee.
Aber das wird wahrscheinlich so nicht klappen, weil die internen Widersprüche, die Gegnerschaften in der afghanischen Gesellschaft so komplex und vielfältig sind, dass die Taliban eigentlich dafür Sorge tragen müssten, durch ein geeignetes Repräsentationssystem genügend Formen von Legitimität im Land zu schaffen. Und da haben sie bisher im Großen und Ganzen versagt. Als Kriegspartei konnten sie das Ganze bisher nur aufs Kriegsgeschehen ausrichten. Und wenn jetzt der Krieg endet, müssen sie irgendeine Raison schaffen, warum sie überhaupt da sind. Da genügen Islam und das alte paschtunische Ideal einer Sittenordnung nicht mehr, weil diese Sittenordnung das Ganze nicht mehr trägt.
Einige diskutieren schon jetzt, ob sie dem iranischen Modell folgen sollen und eine Art von bipolarer Ordnung aufbauen, also das Emirat als religiös-moralische Aufsichtsbehörde der Regierung als Exekutive gegenüberstellen beziehungsweise überordnen. Oder sie werden versuchen, eine institutionelle Innovation im Land durchzusetzen, wenn es ihnen denn gelingt, ihre internen Widersprüche irgendwie zu überwinden. Ich glaube, sie werden letztendlich an sich selbst scheitern.
Gegneranalyse: Wie groß sind die Widersprüche innerhalb der Taliban zwischen der Kandahar- und der Haqqani-Fraktion?
Schulze: Selbst in den paschtunischen Pro-Taliban-Informationen zu dem Konflikt entsteht der Eindruck, dass es sich hierbei um einen sehr tiefgehenden Mehrebenenkonflikt handelt. Man wird nicht, wie die USA sich das vorstellen, die Haqqanis sozusagen als Terroristenverband von den Taliban trennen können, um dann mit den „eigentlichen“ Taliban agieren zu können. Das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren, weil die Haqqanis über eine Hausmacht verfügen und eine soziale Machtstellung vor allem unter den sich als deklassiert fühlenden Ghilzai-Paschtunen haben. Sie haben ein bestimmtes soziales Netz, in dem sie erfolgreich sind und dann auch ihre Macht entfalten können. Es sind die Haqqanis, die beispielsweise derzeit die Polizeimacht in Kabul ausüben. Es wird ein großer Widerspruch zu den Kandahar-Traditionalisten aufkommen, die sich viel stärker auf die Ideale der alten Talibanbewegung orientieren.
Gegneranalyse: Den Taliban wird unterstellt, dass sie keine internationale islamitische Agenda betreiben würden. Allerdings wurde den Haqqanis in der Vergangenheit enge Verbindungen zu Al-Qaida nachgesagt. Besteht mit der Machtbeteiligung der Haqqanis die Gefahr, dass von Afghanistan wieder islamistischer Terror exportiert wird?
Schulze: Die Agenda der Haqqani wird eher sein, sich von der Oberhoheit Pakistans zu lösen. Das ist wahrscheinlich deren Hauptanliegen. Das heißt, wenn es einen Export ihrer Aktivitäten gibt, dann richtet sich dieser eher in Richtung Pakistan. Und das es ist ja, was die pakistanischen Behörden im Moment sehr befürchten.
Al-Qaida selbst sind nicht mehr viele Leute. Die UNO schätzt sie auf noch maximal 500 bis 2000 Leute. Das sind also keine starken Truppen mehr. Von daher würde ich vermuten, dass dort keine strategische Ausrichtung auf Terrorexport in Richtung Westen stattfindet.
Hingegen gibt es immer noch genügend Romantiker in der westlichen Welt, die sich durch diese Ermächtigung der Taliban ihre eigene Islamfantasie zurechtlegen und sich dann ermächtigt sehen, die „Gottesfeinde“ direkt in der Welt, in der sie leben, anzugreifen. Aber das wird nicht mehr als eine Art Befehlskette aus Afghanistan anzusehen sein, sondern als eine Form von Selbstermächtigung, die hier in den Kontexten der europäischen Gesellschaften entsteht.
Gegneranalyse: Sind ISIS‑K eine relevante Größe in Afghanistan oder war der Anschlag am Flughafen ein Zufallserfolg? Muss man mit denen rechnen?
Schulze: Auf jeden Fall. Sie sind jedenfalls für die afghanische Situation relevant. Das wissen die Taliban sehr genau. Der IS ist ihr Hauptfeind Nummer eins, gar nicht so sehr die afghanische Widerstandsfront. Es sind diese ultrareligiösen Verbände, die in Ostafghanistan soziale Nischen gefunden haben. Und weil sie – diese Ultrareligiösen – eine so starke Antithese zu den Taliban aufgebaut haben, und auch unter den Leuten, die von außen aus Usbekistan oder Tadschikistan kommen, ein attraktives Nest, eine Nische anbieten, stellen sie als transnational agierender Verband für Taliban eine Gefahr dar. Wenn dort die Auseinandersetzung zunimmt, haben wir Verhältnisse wie in Syrien. Dann könnte es durchaus passieren, dass wieder in Europa rekrutiert wird, jetzt nach Wasiristan zu gehen und dort im Namen des Islamischen Staates den Kampf gegen die Taliban aufzunehmen. Und dann könnte es zu einer Wiederholung der Situation von 2015, 2016 kommen.
Gegneranalyse: Ist die Antithese gegenüber den Taliban, dass diese zu lasch seien?
Schulze: Aus der Sicht des Islamischen Staats sind das Abtrünnige, Apostaten, Ungläubige und ganz fürchterliche Menschen. Sie haben eine völlig andere Islaminterpretation als die Taliban und diese vollkommene, fundamentale Differenz drückt sich eben darin aus, dass sie die Taliban direkt als Gottesfeinde angreifen und umzubringen versuchen.
Gegneranalyse: Steht Pakistan der Kandahar-Fraktion der Taliban politisch am nächsten?
Schulze: Pakistans Spiel ist undurchsichtig. Zum einen wird der Regierung ein enger Kontakt zu den Kandahar-Traditionalisten nachgesagt, zum anderen scheint aber der pakistanischen militärische Geheimdienst ISI mit den Haqqanis zu kooperieren. Hier ist viel im Fluss. Die jüngsten Ereignisse deuten darauf hin, dass Pakistan auf Distanz zu den Kandaharis geht.
Gegneranalyse: Kann also Pakistan mit der aktuellen Situation zufrieden sein, weil sie mit der Machtergreifung der Taliban ihr Ziel erreicht haben?
Schulze: Ähnlich wie die Türkei in Syrien versucht auch Pakistan eine Aufsichtsmacht über die Gruppen im Nachbarland Afghanistan darzustellen. Warum? Ähnlich wie in der Türkei besteht die Gefahr, dass die Paschtunen anfangen, ihren Nationalismus so zu ethnisieren, dass er sich auch gegen Pakistan richtet. Die Paschtunen leben beiderseits der Grenze. Es ist für Pakistan der größte Alptraum, dass die 1893 gezogene Durand-Grenzlinie zwischen beiden Ländern irgendwann in Frage gestellt wird. Von daher müssen sie Kontrolle über Afghanistan ausüben, um auch im eigenen Haus Ruhe zu haben. Das erklärt, warum die Gegner Pakistans in Afghanistan die Pakistani als Punjabi interpretieren. Diese Gegner gibt es auch unter denn Paschtunen, die nun vehement für ein Paschtunistan als neuen Staat werben; dieser könne getrost auf den Norden Afghanistans verzichten und brauche die Tadschiken und Usbeken nicht mehr. Das ist genau das, was Pakistan befürchtet. Und da Indien dieses Feuer in Afghanistan schürt, fühlen sich die Pakistanis dermaßen eingezwängt, dass sie versuchen, in Afghanistan eine Art von Protektoratsmacht aufzubauen.
Das alles wird noch komplizierter, sollten Iran oder Russland versuchen, eine ähnliche Position aufzubauen, wie sie in Syrien oder Jemen existiert. Wenn sich die Revolutionsgarden entscheiden, dass sie die tadschikische Nationale Widerstandsfront in Afghanistan unterstützen müssen und vielleicht sogar eigene Verbände wie die von ihnen ausgebildeten Fatemiyoun-Brigaden, die noch in Syrien stationiert sind, dorthin entsenden, dann haben wir genau dieselbe Situation, wie wir es jetzt in Syrien, im Irak oder in Jemen haben.
Gegneranalyse: Warum sollte auch Russland die schiitischen Kräfte in Afghanistan unterstützen?
Schulze: Erstens haben sie schon lange die Allianz mit Iran aufgebaut. Und zweitens versucht Russland auf diese Art und Weise sowohl die Verbindung zwischen den Taliban und China zu torpedieren als auch klarzumachen, wer eigentlich in Zentralasien in diesem neuen Great Game das Sagen hat.
Prof. Dr. Reinhard Schulze ist Direktor des Forum Islam und Naher Osten (FINO) an der Universität Bern. Er ist sehr aktiv auf Twitter (@SchulzeRein) und kommentiert hier regelmäßig aktuelle Entwicklungen in Afghanistan.
Das Interview führte Christoph Becker.
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.