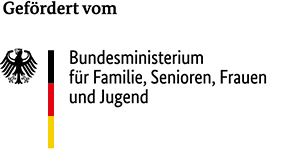Carl Schmitt
Antiliberalismus, identitäre Demokratie und
Weimarer Schwäche
von Jens Hacke
„Europas brillantester Jurist ist wieder en vogue“, schrieb die britische Financial Times zu Beginn des Europawahljahres 2019. Der Staatsrechtler Carl Schmitt (1888–1985) bleibt bis heute eine hoch umstrittene und schillernde Figur, „ein gefährlicher Geist“ (Jan-Werner Müller), dessen Gedankengut vor allem antiliberale Feuerköpfe stimulierte. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass Schmitts Verfassungslehre wesentlichen Einfluss auf den Entstehungsprozess des Grundgesetzes hatte und dass Modifikationen wie das konstruktive Misstrauensvotum, die sogenannte Ewigkeitsklausel für bestimmte Verfassungsartikel und die Konzeption einer wehrhaften Demokratie auch mit seiner Kritik an der Weimarer Reichsverfassung in Verbindung stehen.
Die Debatte, ob man ihn als Klassiker des politischen Denkens behandeln dürfe, dauert schon Jahrzehnte. Seine zwielichtige Stellung hat ihren Grund in Schmitts politischer Exponierung. Er gilt nach wie vor als das Paradebeispiel eines antiliberalen, mit dem Faschismus sympathisierenden Intellektuellen, der sich mit Ehrgeiz, Opportunismus und ungehemmtem Antisemitismus dem Nationalsozialismus zur Verfügung stellte.
Der Streit, ob er ein genuiner Nationalsozialist war oder ob er sich lediglich anpasste, verfehlt allerdings den Charakter der nationalsozialistischen Ideologie. Denn der Nationalsozialismus hat sich einer programmatischen Fixierung weitgehend entzogen und war zumindest in seiner Formationsphase vor allem eine Projektionsfläche für ganz verschiedene radikale Vorstellungen.
Die Liste der Ideologeme und Affekte, die dabei halfen, sich als Nationalsozialist zu fühlen, ist lang: Vehementer Antisemitismus, radikaler Antiliberalismus, Autoritätsdenken, extremer Nationalismus, Rassismus, das Streben nach außenpolitischer Revision gehören dazu. Carl Schmitt und Martin Heidegger teilten als prominente Universitätsprofessoren solche Überzeugungen und wollten dem neuen Staat ein intellektuelles Profil liefern. Dass beide die Macht des Geistes grandios überschätzten, zeigte sich vor allem darin, dass das Régime sie schon bald nicht mehr brauchte. Allerdings führte das weder den einen noch den anderen in den Widerstand. Es gibt also keinen Grund, bei diesen beiden Denkern von Verirrungen zu reden. Das meiste, was sie taten, bewegte sich durchaus in der Konsequenz dessen, was sie vorher bereits dachten.
Schmitt war ein sogenannter „Märzgefallener“, der sich der NSDAP erst nach „Machtergreifung“ und „Ermächtigungsgesetz“ anschloss. Vorher hatte er auf andere autoritäre Optionen gesetzt; ganz sicher aber wollte er die parlamentarische Demokratie Weimars überwinden. Berüchtigt ist sein Artikel „Der Führer schützt das Recht“, mit dem er die Morde des sogenannten „Röhm-Putsches“ im Sommer 1934 legitimierte; eine furchtbare Lektüre sind auch seine zahlreichen Ausfälle gegen jüdische Kollegen und gegen das Judentum allgemein. Wie Schmitt seine Karriere im NS verfolgte, auf welche Weise er hier intellektuelle Führungsarbeit leisten wollte und wie gnadenlos er seine Interessen durchsetzte, das lässt sich mittlerweile fast lückenlos rekonstruieren. (1)
Schmitt, geboren 1888, war ein Kind des Kaiserreiches, entstammte einer kleinbürgerlichen katholischen Familie aus dem Sauerland, habilitierte sich bereits im Alter von 26 Jahren als Jurist und entging als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg dem Fronteinsatz, weil er es schaffte, im Behördendienst zu verbleiben. Er kultivierte das Leben eines Bohemiens, der auch Beziehungen zu künstlerischen Kreisen pflegte und einen für seine Zeit nicht untypischen bürgerlichen Selbsthass verinnerlichte.
Seine wissenschaftlich produktivste Zeit erlebte Carl Schmitt in der Weimarer Republik, als in den roaring twenties seine fundamentalpolitischen Schriften in dichter Folge erschienen und er von einem vielstimmigen intellektuellen Klima profitierte, das ihn keineswegs nur mit rechtsnationalen, sondern auch mit liberalen und linken Denkern in Verbindung treten ließ.
1. Weimarer Ausnahmezustand und die Sehnsucht nach Ordnung
Schmitts unmittelbare zeitgenössische Erfahrung war geprägt von Untergang, Kriegsniederlage, Verlust der Ordnung. Das war dem unmittelbaren Erleben nach 1918 geschuldet – die Kämpfe im Zuge der Novemberrevolution, der Kapp-Putsch 1920, die politischen Morde der rechtsradikalen Freikorps, die Ruhrbesetzung 1923. Schmitt dachte national, empfand Versailles und die Gründung des Völkerbundes als Farce und betrachtete die junge Weimarer Republik als einen schwachen Staat, der von unterschiedlichen Interessengruppen und Weltanschauungsparteien zerrieben wurde. Aus dieser Haltung heraus artikulierte Schmitt früh und fast schon manisch die eigene Sehnsucht nach Ordnung.
1923 veröffentlichte er in der Erinnerungsgabe für Max Weber den Beitrag „Soziologie des Souveränitätsbegriffs und politische Theologie“ (SdS). Er begann mit dem berühmten und viel zitierten Satz:
„Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“ (SdS, S. 5)
Schmitts Begriff der Souveränität
Schon kurz zuvor hatte Schmitt sich mit der Diktatur als republikanischer Institution für den Ausnahmezustand, das heißt vor allem im Krieg oder Bürgerkrieg, beschäftigt und darüber nachgedacht, inwiefern der ursprünglich kommissarisch eingesetzte Diktator als Ordnungsstifter eine neue Staatsform, nämlich die souveräne Diktatur, hervorbringen könne.
Nicht ohne Hintersinn akzentuierte er mit der Souveränität einen klassischen politischen Begriff: Der Anspruch der „Volkssouveränität“ prägte die junge Weimarer Demokratie, während gleichzeitig die fehlende nationalstaatliche Souveränität des durch den Versailler Vertrag gebundenen Deutschen Reiches als offene Wunde empfunden wurde.
Als Souveränität verstand Schmitt die „höchste, rechtlich unabhängige, nicht abgeleitete Macht“ (SdS, S. 13). Sie ist vor dem Staat da, sie ist eigentlich erst staatsbegründend. Darin lässt sich eine Anlehnung erkennen an den von Schmitt bewunderten Thomas Hobbes, dessen Souverän nach der Einsetzung durch einen fiktiven Vertrag aller mit allen erst den Naturzustand eines Krieges aller gegen alle überwindet und eben Ordnung stiftet. „Auctoritas non veritas facit legem“, das ist der Hobbes’sche Kernsatz, den Schmitt immer wieder zitiert. „Die Autorität, nicht die Wahrheit, schafft das Gesetz.“
Ins Zentrum tritt also das Nachdenken über Voraussetzungslosigkeit der politischen Entscheidung.
„Die Entscheidung ist, normativ betrachtet, aus einem Nichts geboren. Die rechtliche Kraft der Dezision ist etwas anderes als das Resultat ihrer Begründung. Es wird nicht mit Hilfe einer Norm zugerechnet, sondern umgekehrt; erst von einem Zurechnungspunkt aus bestimmt sich, was eine Norm und was normative Richtigkeit ist.“ (SdS, S. 24)
Es gibt also keine vorgeordnete Rechtsidee und keine favorisierte Verfassungsform, die Schmitt als Ideal oder Normvorstellung erklärt. Die Etablierung einer Staatsidee, die dann aus sich selbst heraus entsteht, bleibt illusorisch. Es muss eine Instanz geben, die entscheidet und den Staat in Werk setzt. Staatlichkeit wird an die Fähigkeit zur souveränen Entscheidung geknüpft.
Schmitts Denken umkreist in der staatsrechtlichen Debatte das Problem, an welcher Stelle die Weimarer Verfassung eine Möglichkeit lässt, einen solchen starken Entscheider zu etablieren.
Später sollte Schmitt im vom Volk gewählten Reichspräsidenten den „Hüter der Verfassung“ erblicken. Eine Diktatur des Reichspräsidenten, der die Einheit des Volkswillens verkörpere und mit Notverordnungen sogar verfassungsgemäß regieren konnte, bot für Schmitt einen gangbaren Weg durch die Staatskrise.
Apologeten Schmitts halten sich bis heute daran fest, dass Schmitt keineswegs als Totengräber der Weimarer Republik betrachtet werden dürfe, sondern eigentlich den Weg zu ihrer Rettung und zur Abwendung Hitlers wies.
In der Tat rufen Staatsrechtler selten zur Revolution auf. Sie arbeiten sich am geltenden Staatsrecht ab und suchen von dort aus Lösungen. Auch solche, die eine sukzessive Transformation der Verfassung bedeuten können.
2. Antiliberalismus und identitäre Demokratie
In seiner ideenpolitisch wichtigsten Schrift „Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus“ (1923/26) wollte Schmitt zeigen, dass die gerade erst etablierte parlamentarische Demokratie auf völlig veralteten Prämissen aufbaue, die nichts mehr mit den gesellschaftspolitischen Realitäten zu tun hätten und nun unvereinbar geworden seien – sie beruhe auf Überzeugungen einer bürgerlichen Klasse, die es gar nicht mehr gebe. Die Prinzipien des Parlamentarismus sah er als Ausfluss liberaler Ideologie. Öffentlichkeit und Diskussion konstituieren die Idee des Parlaments, das heißt es herrscht der Glaube daran, dass ein Wettstreit der Meinungen zu Ergebnissen und Kompromissen führen, die als beste Lösungen anzusehen sind. Keine definitiven Resultate, keine letztgültige Wahrheit, aber ein Ausgleich der pluralistischen Interessengruppen.
Nicht nur sei in der Realität niemand an ehrlichen Kompromissen interessiert, es gebe auch gar keinen Willen zur Diskussion. Im Parlament stehen sich die verschiedenen Weltanschauungsparteien unversöhnlich gegenüber, es gibt nur noch Meinungs- und Interessenfronten, aber keinen Platz für Argumente, keinen Willen zum wirklichen Gespräch, schon gar nicht zur Einigung. Die politischen und sozialen Gegensätze sind in der Massendemokratie so groß geworden, dass sie nicht mehr über den Parlamentarismus integriert werden können.
Schmitts entscheidender Kniff liegt in der Kontrastierung von Liberalismus und Demokratie just in dem historischen Moment, als beide in der Verfassungsordnung der Weimarer Republik zum ersten Mal zusammengefunden hatten. Liberalismus steht für Pluralismus, Diskussion, Gewaltenteilung, die allesamt die Schwäche und Entscheidungsunfähigkeit des gegenwärtigen parlamentarischen Systems belegen sollen.
Die Schmittsche Bestimmung der Demokratie erscheint dagegen in hellem Licht: Sie soll im Sinne Rousseaus als Identität von Regierenden und Regierten aufgefasst werden und kann, im Gegensatz zum endlosen Gespräch im Parlament, direkt vom Volk legitimierte Entscheidungen ermöglichen. Dafür präferiert Schmitt das Mittel der öffentlichen Akklamation – und ignoriert absichtsvoll die individuellen Freiheitsrechte. Die geheime Wahl hält er für einen undemokratischen Akt, weil es den Bürger „in tiefstem Geheimnis und völliger Isoliertheit“ unbeobachtet lässt (also keineswegs der liberalen Forderung nach Öffentlichkeit und Transparenz entspricht), um später dann lediglich eine arithmetische Mehrheit zu berechnen:
„Je stärker die Kraft des demokratischen Gefühls, um so sicherer die Erkenntnis, daß Demokratie etwas anderes ist als ein Registriersystem geheimer Abstimmungen.“ (GLP, S. 22)
.
Der demokratische Führer
Nach Schmitts Auffassung kann das Volk lediglich auf eine ihm vorgelegte Frage mit Ja oder Nein antworten. Entscheidend wird das Geschick plebiszitärer Führung, das Volk durch die gelenkte Mobilisierung als homogene Einheit hinter sich zu versammeln.
Aus dieser Logik heraus sieht Schmitt auch keinen notwendigen Gegensatz zwischen Demokratie und Diktatur. Wenn Schmitt sich für die Anerkennung demokratischer Grundsätze ausspricht, dann beschränkt sich sein Interesse darauf, wie eine Identifikation der Herrschenden mit den Beherrschten zustande kommen kann.
Es geht ihm also um die „Bildung und Formierung des Volkswillens“ – auch hier finden wir dann die Ausläufer einer politischen Theologie, nach der alle politischen säkularisierte theologischen Begrifflichkeiten entspringen, denn, wie er schreibt, „der Glaube das alle Gewalt vom Volke kommt, erhält eine ähnliche Bedeutung wie der Glaube, daß alle obrigkeitliche Gewalt von Gott kommt“ (GLP, S. 41)
Ein Diktator ist also durchaus in der Lage, seine Herrschaft nach Schmitts Kriterien demokratisch zu legitimieren:
„Es kann eine Demokratie geben ohne das, was man modernen Parlamentarismus nennt und einen Parlamentarismus ohne Demokratie; und Diktatur ist ebensowenig der entscheidende Gegensatz zu Demokratie wie Demokratie der zu Diktatur.“
(GLP, S. 41)
.
So waren für Schmitt Bolschewismus und Faschismus zwar „wie jede Diktatur antiliberal, aber nicht notwendig antidemokratisch“. (GLP, S. 22)
Insbesondere von Mussolinis Faschismus in Italien zeigte sich Schmitt fasziniert. In ihm erkannte er neue Methoden und Formen, „den Willen des Volkes zu bilden und Homogenität zu schaffen“ (GLP, S. 22), und Mussolini schien in der Lage, den Mythos des Nationalen kraftvoll zu erneuern.
Drei Aspekte, die Schmitts Denken Mitte der 1920er Jahre prägen, lassen sich festhalten.
- Erstens geht es ihm darum, gegen den Trend der Zeit Liberalismus und Demokratie nicht nur voneinander zu trennen, sondern eigentlich gegeneinander auszuspielen. Während das Parlament nicht in der Lage ist, eine in sich gespaltene liberale Gesellschaft zu repräsentieren, kann es einem Diktator gelingen, das Volk zu einer Einheit zu verschmelzen.
- Damit ist zweitens bereits ein Kernbegriff genannt, der auch Schmitts „Begriff des Politischen“ prägen wird: Homogenität. „Zur Demokratie gehört notwendig erstens Homogenität und zweitens – nötigenfalls – die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen.“ (GLP, S. 14) Diese martialische Diktion findet sich schon in der Einleitung zur zweiten Auflage der „Geistesgeschichtlichen Lage“ von 1926. Ausscheidung und Vernichtung des Heterogenen sowie die Herstellung von „substantieller Gleichheit“ werden, zunächst noch abstrakt, zu formalen Kriterien der Demokratie.
- Drittens muss sich die Demokratie nach Schmitts Auffassung von universalen Werten verabschieden.
„Bisher hat es noch keine Demokratie gegeben, die den Begriff des Fremden nicht gekannt und die Gleichheit aller Menschen verwirklicht hätte“, schreibt Schmitt.
„Menschheitsdemokratie“ oder „absolute Menschengleichheit“ sind für Schmitt unpolitische (und damit naïve) Begriffe. Demokratie lebt von ihrem Homogenitätspostulat und der scharfen Abgrenzung nach außen.
Wenn hier auch noch nicht vom Feind die Rede ist, so benötigt die Demokratie jedoch den Fremden als Gegenbild. Es nimmt kaum Wunder, dass diese Form der „illiberalen Demokratie“ – eine Formel, die übrigens Wilhelm Röpke 1933 für den Nationalsozialismus erstmals verwendete – sichtbare Parallelen zu rechtspopulistischen Strömungen der Gegenwart aufweist.
3. Der Begriff des Politischen
Schmitts berühmteste Schrift ist ein Text, den man sich voller Ausrufezeichen denken könnte; eine Fülle von martialischen Wendungen und polemischen Behauptungen halten den Leser in Atem. Schmitts stilistischer Brillanz, seiner Suggestionskraft und der Prägnanz seiner Formulierungen wohnt ein Überwältigungseffekt inne. Schmitt ist kein stumpfer Konservativer, sondern ein Intellektueller, der nicht nur die Klassiker, sondern auch die Avantgarde-Autoren seiner Zeit gelesen hat.
„Der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus.“ (BdP, S. 20)
Dieser fanfarenhafte Auftakt signalisierte, dass der Staat erst aus dem politischen Konflikt entsteht beziehungsweise die Aufgabe hat, diesen zu befrieden. Klassisch hobbesianisch beendet der Staat einen Zustand der Anomie und stiftet Ordnung. Allerdings wollte Schmitt die Krise des Staates in seiner Gegenwart erläutern und nicht seine Entstehungsgeschichte erzählen. Darüber hinaus setzte sich Schmitt deutlich von herrschenden Auffassungen ab, die Politik als Staatshandeln begreifen, und wendet sich gegen die Gleichung staatlich = politisch.
Das Politische ist für Schmitt kein fest umrissenes Gebiet. Alle Fragen, seien sie religiöser, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder kultureller Art eignen sich für eine Politisierung. Um sie können sich existentielle Gegensätze, also Freund/Feind-Gruppierungen bilden.
Aus Schmitts Sicht hat der Staat der Moderne nach und nach die Kontrolle über das Politische abgegeben. Er steht nun einer Gesellschaft gegenüber, in der alles Mögliche zum Streitfall werden kann.
.
Der totale Staat
Die Gesellschaft wird einerseits zur Bedrohung des klassischen Staates, wenn man ihn als hierarchische Ordnungsmacht versteht; andererseits führt die Einbeziehung immer neuer Gebiete und Problemfelder, um die sich der Staat kümmern muss, zu dessen Totalisierung. Wenn der Staat also zum Institut der gesellschaftlichen Selbstorganisation geworden ist, wird er total – in seinen Aufgaben und in den Ansprüchen, die an ihn gestellt werden.
Der „totale Staat“ ist für Schmitt eine ambivalente Kategorie: zum einen total aus Schwäche, weil er an einer quantitativen Überforderung leidet und deshalb handlungsunfähig wird; zum anderen wird Schmitt zum Fürsprecher eines qualitativ totalen Staates, der sich wieder als entscheidungsfähig und ordnungsstiftend erweist.
Wenn Schmitt verschiedentlich als Konservativer, als Etatist oder als Nationalist klassifiziert wird, vernebeln solche Bezeichnungen häufig mehr als sie erklären. Ist jemand ein Konservativer, der die Entwicklung des Staates in der Moderne so problematisch ansieht, dass er den Institutionen nicht mehr vertraut? Was konnte in Weimar konservativ überhaupt heißen? Schmitt war gewiss niemand, der sich nach der Hohenzollernmonarchie zurücksehnte und dem Kaiser nachtrauerte. Schmitt war ein Modernist, den das neue Phänomen der Massengesellschaft faszinierte, und er zog sich keineswegs auf den Standpunkt des konservativen Kulturkritikers zurück. Ihm war bewusst, dass es keinen Weg zurück zu überkommenen Regierungsformen geben konnte. Seine Bewunderung für Mussolini und den Faschismus, den er als quasi-demokratische Herrschaftstechnik deutete, war von Euphorie getragen. Den Faschismus sah er in Verwandtschaft zum Leninismus, indem es ihm gelang einen politischen Mythos zu beschwören (Nation/Klasse) und eine wirksame Freund/Feind-Unterscheidung zu etablieren (Volk/Volksfremde bzw. Proletariat/Bürgertum).
Auch die Bezeichnung als Etatist, also als jemand, der das gesamte politische Denken den Erfordernissen des Staates und der Staatsräson unterordnet, ist nur bedingt aussagekräftig. Er registriert ja gerade die Schwäche des Staates und kritisiert, dass sich der moderne Staat in eine Sackgasse der Selbstüberforderung hineinmanövriert habe. Die Weimarer Republik sieht er zudem als eine Schwundform des Staates an: es fehlt ihr nach Kriegsniederlage und Versailler Vertrag an Souveränität und am Willen außenpolitischer Selbstbehauptung. Insofern war Schmitt sicherlich auch ein deutscher Nationalist.
Sein Verständnis der deutschen Nation ist aber nicht so einfach zu greifen, vor allem später, wenn er Reichs- und Großraumideen ventiliert, die gewiss nicht mehr auf den Nationalstaat zu beziehen sind.
In Schmitt finden wir also exemplarisch jene politischen Widersprüche vereint, die das Lager einer sogenannten „Konservativen Revolution“ prägten. (2) Ihr gemeinsamer Nenner ist nicht programmatisch zu fassen, sondern sie sind vor allem in ihren Abneigungen verbunden: gegen den Liberalismus, gegen die Weimarer Demokratie, gegen bürgerliche Lebensformen.
Die Ausweitung des Politischen
Wenn das Politische kein festumrissenes Gebiet mehr ist, dann wird die Bestimmung des Feindes zu einem dezisionistischen Akt, der weder eine moralische Begründung noch eine rational nachvollziehbare Erklärung braucht. Ein existenzieller Gegensatz kann religiös, ökonomisch, national, ethnisch, ästhetisch oder auch andere irrational begründete Feindbestimmungen zur Folge haben (BdP, S. 26 f.). Wichtig ist nur der Intensitätsgrad der Konfrontation. Die Kehrseite der Feindbestimmung ist dann die Homogenisierung im Inneren, die auf Gleichartigkeit abstellt (und später zur rassistischen „Artgleichheit“ wird). Das wäre dann wohl die Freundschaft, zu der Schmitt aber nichts Näheres mitzuteilen hat.
Eine weitere wichtige Pointe ist, dass für die von Schmitt visionierte äußerste Form des Konflikts jede Rechtsregel auszufallen scheint. Will man dem Recht eine Rolle zumessen, so hat es wohl nur die Bedingungen der Homogenität zu bestimmen und zu ordnen. Dies widerspricht einer liberalen Rechtsauffassung, nach der Pluralität organisiert und geschützt wird, indem individuelle Freiheit und die Rechte der Minderheiten zu garantieren sind.
Der Krieg als Höhepunkt
Während die Verteidiger Schmitts gern auf die abstrakte Formalität der Unterscheidung zwischen Freund und Feind aufmerksam machen, entzündet sich die Schmitt-Kritik schnell daran, dass er den Krieg als äußerste Steigerung des politischen Konflikts, ja als Höhepunkt des Politischen deutet. Daran lässt sich eigentlich kaum zweifeln. So heißt es deutlich, dass zum Begriff des Feindes „die im Bereich des Realen liegende Eventualität des Kampfes“ gehöre.
Die Begriffe Freund, Feind und Kampf erhalten ihren realen Sinn dadurch, daß sie insbesondere auf die reale Möglichkeit der physischen Tötung Bezug haben und behalten. Der Krieg folgt aus der Feindschaft, denn diese ist seinsmäßige Negierung eines anderen Seins. Krieg ist nur die äußerste Realisierung der Feindschaft. Er braucht nichts Alltägliches, nichts Normales zu sein, auch nicht als etwas Ideales oder Wünschenswertes empfunden zu werden, wohl aber muß er als reale Möglichkeit vorhanden bleiben, solange der Begriff des Feindes seinen Sinn hat.“ (BdP, S. 33)
.
Schmitt wendet damit die Kategorien zwischenstaatlicher Konflikte auf innenpolitische Verhältnisse an. Die reale Möglichkeit des Staatenkrieges, die den Handlungsraum der internationalen Politik bestimmt, wird zur Parallele innerstaatlicher Politik, die ständig mit der Gefahr des Bürgerkrieges zu rechnen hat. Schmitts existentieller Begriff des Politischen macht das Opfer des Lebens und die Tötungsbereitschaft zur letzten Kategorie und orientiert sich am Ausnahmezustand.
4. Liberalismus als Denaturierung der Politik
Für Schmitt steht außer Frage, dass der Liberalismus für die, wie er es nennt, Denaturierung der politischen Vorstellungen verantwortlich ist. „Vom konsequent bürgerlichen Liberalismus“ lasse sich „keine politische Theorie gewinnen“:
Denn die Negation des Politischen, die in jedem konsequenten Individualismus enthalten ist, führt wohl zu einer politischen Praxis des Mißtrauens gegen alle denkbaren politischen Mächte und Staatsformen, niemals aber zu einer eigenen positiven Theorie von Staat und Politik“ (BdP, S. 68/69)
schreibt Schmitt.
Liberale Kritik kämpft gegen die Staatsgewalt, will den Staat hemmen und kontrollieren. Während eine politische Einheit, also der Staat, „gegebenenfalls das Opfer des Lebens verlangen“ muss, schützt der Liberalismus die individuelle Freiheit:
„Alles liberale Pathos wendet sich gegen Gewalt und Unfreiheit. Jede Beeinträchtigung, jede Gefährdung der individuellen, prinzipiell unbegrenzten Freiheit, des Privateigentums und der freien Konkurrenz heißt ‚Gewalt’ und ist eo ipso etwas Böses. Was dieser Liberalismus von Staat und Politik noch gelten lässt, beschränkt sich darauf, die Bedingungen der Freiheit zu sichern und Störungen der Freiheit zu beseitigen.“ (BdP, S. 70)
Diese Bestandsaufnahme ist von Schmitt verächtlich gemeint. Denn er zeigt keinen Sinn für das von Kelsen und anderen betonte Verdienst der liberalen Demokratie: den sozialen Frieden zu sichern und eine Konflikte prozedural auszutragen. Aus Schmitts Sicht vermag es der Liberalismus hingegen nicht mehr, eine klare Unterscheidung von Krieg und Frieden zu treffen, und der eigentlich notwendige Kampf wird in Diskussion und Konkurrenz aufgelöst.
„Aus dem politisch geeinten Volk wird auf der einen Seite ein kulturell interessiertes Publikum, auf der andern teils ein Betriebs- und Arbeitspersonal, teils eine Masse von Konsumenten.“ (BdP, S. 71)
Das mochte Schmitt nur als zivilisatorische Verweichlichung verstehen.
Kritik am Universalismus
Ein weiterer Angriffspunkt war der vermeintlich naïve Universalismus der Menschenrechte und die irrealen Träume vom Erfolg des Völkerbunds – jede Vision eines Weltstaates hält Schmitt für illusorisch. Weltfrieden, Menschheit – das waren für Schmitt unpolitische Begriffe, die keine Feindschaft mehr zuließen.
„Wer Menschheit sagt, will betrügen“ (BdP, S. 55),
schleudert Schmitt allen Vertretern des Kosmopolitismus entgegen. Das liberale Denken hatte es aus Schmitts Sicht verlernt, sich mit den harten politischen Realitäten auseinanderzusetzen. Aber es war nicht nur naiv, sondern verbrämte materielle Interessen mit einer Pseudo-Ideologie, die jede Denkmöglichkeit des Krieges und der kampfbereiten Bewährung verbannte. Schmitt vertrat angesichts der neuen und machtvollen antiliberalen Bewegungen des Bolschewismus und des Faschismus die Auffassung, dass der Liberalismus und die liberale Demokratie, die unpolitische Werte wie Frieden, Toleranz und Pluralismus hochhielt, zum Scheitern verdammt waren.
5. Bedeutung und Rezeption
Als Ernst Jünger die erste Fassung der Begriffsschrift 1930 las, schrieb er sogleich an den Verfasser, dass jede Stellungnahme eigentlich überflüssig sei, dass die Broschüre allein durch den „Grad ihrer unmittelbaren Evidenz“ überzeuge. Schmitt sei „eine besondere kriegstechnische Erfindung gelungen: eine Mine, die lautlos explodiert“. (3)
Selbst diese von Sympathie getragene Mitteilung ist bemerkenswert: Jünger betont nämlich eher das Zerstörerische als das Konstruktive von Schmitts Theorie. Dass Schmitt in kühler Diktion und mit einem neuen begrifflichen Besteck weit verbreitete Ressentiments gegen die parlamentarische Demokratie bündelte, war aufmerksamen Zeitgenossen früh aufgefallen. Sein Staatsrechtlerkollege Richard Thoma etwa warf ihm vor, ein Bild von liberaler Öffentlichkeit und Diskussion zu entwerfen, an das Liberale selbst nie geglaubt hätten. Außerdem hätte Schmitt weder den Wandel demokratischer Institutionen noch die sozialpolitischen Integrationsfähigkeiten der liberalen Demokratie gewürdigt. (4)
Hermann Heller, ein sozialdemokratischer Staatsrechtler, mit dem Schmitt zunächst ein gutes kollegiales Verhältnis verband, griff Schmitts Kritik an der Wehrhaftigkeit des liberalen Staates auf. „Ein Staat, der den tödlichen Waffengebrauch unter allen Umständen verbieten würde, der nicht schießen lässt, wenn auf seine Repräsentanten von drinnen und draußen geschossen wird, hebt sich selbst auf“, schrieb Heller im Blick auf eine wehrhafte Demokratie. (5) Für Heller war diese Wehrhaftigkeit allerdings an Werte gebunden. Schmitts Dezisionismus lehnte er ab. Die Freund/Feind-Unterscheidung bleibt zirkulär und unbestimmt, wenn sie nicht an feste politische Wertvorstellungen gebunden ist.
Der Philosoph Karl Löwith hat Schmitts Begriffsnebel treffend gelichtet, indem er dessen Dezisionismus als eine „Entscheidung für die Entschiedenheit“ ironisierte.
Der hohe Abstraktionsgrad der Schmittschen Schrift hat aber bis heute zu vielerlei Auslegungen und Aktualisierungen geführt. In einem nunmehr dreißig Jahre alten Aufsatz mit dem Titel „Carl Schmitt liberal rezipiert“ gestand Hermann Lübbe Carl Schmitt tiefe Einsichten in die Fragilität der liberalen Demokratie zu. Man müsse sich mit ihm beschäftigen – die Aufgabe liege aber darin, sich von seinen Ressentiments zu lösen und den Liberalismus im Gegensatz zu Schmitt zu bejahen. Dann lasse sich das zentrale Begriffsensemble der politischen Theorie Carl Schmitts mühelos zur verfassungsrechtlichen Selbstbehauptung der liberalen parlamentarischen Demokratie nutzen. Schmitt hatte nämlich klar erkannt, dass für die Stabilität der Weimarer Demokratie weithin geteilte republikanische Überzeugungen ebenso wichtig waren wie ein ausgeprägtes Rechtsempfinden.
Schmitts maßgeblicher Text über „Legalität und Legitimität“ skizzierte mit dem „Prinzip der gleichen Chance innerpolitischer Machtgewinnung“ bereits die Grundlinien einer wehrhaften Demokratie:
Denn man kann die gleiche Chance selbstverständlich nur demjenigen offenhalten, von dem man sicher ist, daß er sie einem selber offenhalten würde; jede andere Handhabung eines derartigen Prinzips wäre nicht nur im praktischen Ergebnis Selbstmord, sondern auch ein Verstoß gegen das Prinzip selbst.“ (LuL, S. 34)
„Wertbehauptung und Wertneutralität schließen einander aus“ (LuL, S. 46), wusste Schmitt – insofern benötigt die demokratische Ordnung die Mittel, gegen verfassungswidrige Bestrebungen vorzugehen und das Legalitätssystem vor Missbrauch zu schützen.
Vor diesem Hintergrund plädierte Lübbe dafür, Schmitts Einsichten nutzbar zu machen und den Staat als einen normativ starken Liberalitätsgaranten zu begreifen.
Die bundesrepublikanische Rezeption Carl Schmitt hat lange von anderen Schwerpunkten her gedacht. Sie konnte den Weimarer Hintergrund des drohenden Bürgerkriegs hinter sich lassen. „Vernünftig ist, wer den Ausnahmezustand vermeidet“, so hat Odo Marquard die berüchtigte Souveränitätsformel Schmitts persifliert. Dolf Sternberger, ein Nestor der westdeutschen Politikwissenschaft nach 1945, hat sich denn auch am entschiedensten von Schmitt abgesetzt. Nicht aus dem Ausnahmezustand und der Möglichkeit des Krieges lasse sich die Essenz des Politischen gewinnen, sondern wenn man den Frieden als Ziel der Politik ernst nehme. Wollte man das Wesen des Staates aus dem Bürgerkrieg verstehen, sei das so, wie wenn man das Wesen der Ehe aus der Ehescheidung erklären wolle. (6)
Gleichwohl ist Schmitt in den vergangenen Jahren eine neue Bedeutung zugewachsen. Schon die Neue Linke hatte Schmitts Liberalismuskritik weitgehend übernommen und den Verfall der demokratischen Öffentlichkeit diagnostiziert. In Johannes Agnolis „Transformation der Demokratie“ (1968) findet sich der Antiliberalismus Schmitts prominent, aber auch Jürgen Habermas’ „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (1963) hatte bereits die Parlamentarismuskritik der „Geistesgeschichtlichen Lage“ aufgegriffen.
Mit der zunehmenden Kritik an kosmopolitischen Entwürfen und mit der Frustration angesichts der aufs Akademische beschränkten Wirkung deliberativer Politikkonzeptionen hat Schmitt wieder an Attraktivität gewonnen. Die belgische Politologin Chantal Mouffe darf als prominenteste Schmitt-Adeptin gelten; sie nutzt dessen Begriff des Politischen, um sich von konsensorientierte Politikvorstellungen abzugrenzen. Diese unterschätzten Mouffe zufolge die affektive Dimension des Politischen, weil sie Leidenschaften und Emotionen als konstante Triebkräfte politischen Engagements ignorierten. Zudem bedienten sie vor allem moralische Register und neigten zur Disqualifikation abweichender Meinungen. Mouffe sieht den Links- und Rechtspopulismus als Konsequenz einer Politik der Mitte, die sich alternativlos gibt und die politische Auseinandersetzung nicht zulässt. (7)
Dass sich das Politische außerhalb der normativen Kontexte westlicher Demokratien artikuliert, dass antiwestliche Ideologien, Fundamentalismen und terroristische Strategien dem Begriff des Feindes neuen Sinn geben, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man auch innerhalb der westlichen Demokratie wieder mehr von agonistischen, d.h. kämpferisch betonten Auseinandersetzungen um die Sache ausgeht.
Die wirklichkeitsaufschließende Kraft der Schmitt’schen Theorie hat darum nicht nachgelassen, wenn man ihn zu lesen versteht und sich von seinen ideologischen Optionen, die in den Homogenitätsphantasien und im Antiliberalismus seiner rechten Bewunderer nachhallt, zu distanzieren weiß. Schmitt hat die Einfallstore für die Gegner der liberalen Demokratie in seiner Verfassungslehre und in seiner Analyse der Weimarer Endkrise klar markiert. Ein ernüchtert-realistisches liberales Denken muss auf diese Bedrohungen immer wieder neue Antworten finden. Dabei wird deutlich, dass sich Liberale nicht allein auf die Güte ihrer Argumente verlassen dürfen, sondern den Gegnern der parlamentarischen Demokratie wehrhaft entgegentreten müssen.
![]()
Zitierte Werke von Carl Schmitt
- Soziologie des Souveränitätsbegriffes und politische Soziologie (SdS) in: Melchior Palyi (Hg.), Erinnerungsgabe für Max Weber, München/Leipzig 1923, Bd. 2, S. 3–35.
- Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (GLP), 8. Aufl., Nachdruck der 1926 erschienenen 2. Aufl., Berlin 1996.
- Legalität und Legitimität (1932) (LuL), Berlin 1996, 8. Aufl.
- Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien (BdP), Berlin 1996, 6. Aufl.
Literaturhinweise
- Stefan Breuer: Carl Schmitt im Kontext. Intellektuellenpolitik in der Weimarer Republik, Berlin 2012.
- Hermann Heller: Politische Demokratie und soziale Homogenität (1928), in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 2, Tübingen 1992, 2. Aufl., S. 421–433.
- Hasso Hofmann: Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts, Neuwied/Berlin 1964.
- Stephen Holmes: Die Anatomie des Antiliberalismus, Hamburg 1995.
- Dirk van Laak: Gespräche in der Sicherheit des Schweigens. Carl Schmitt in der politischen Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik, Berlin 1993.
- Christian Linder: Der Bahnhof von Finnentrop. Eine Reise ins Carl Schmitt Land, Berlin 2008.
- Karl Löwith: Der okkasionelle Dezisionismus von Carl Schmitt (1935), in: ders., Heidegger – Denker in dürftiger Zeit. Zur Stellung der Philosophie im 20. Jahrhundert (Sämtliche Schriften 8), Stuttgart 1984, S. 32–71.
- Hermann Lübbe: Carl Schmitt liberal rezipiert, in: Helmut Quaritsch (Hg.), Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt, Berlin 1988, S. 427–440.
- Reinhard Mehring(Hg.): Carl Schmitt –Der Begriff des Politischen. Ein kooperativer Kommentar, Berlin 2003.
- Reinhard Mehring: Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie, München 2009.
- Chantal Mouffe: Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion, Frankfurt/M. 2007.
- Jan-Werner Müller: Ein gefährlicher Geist. Carl Schmitts Wirkung in Europa, Darmstadt 2007.
- Dolf Sternberger: Begriff des Politischen. Mit drei Glossen, in: ders., Staatsfreundschaft (Schriften IV), Frankfurt/M. 1980, S. 293–320.
- Richard Thoma: Zur Ideologie des Parlamentarismus und der Diktatur, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 53 (1925), S. 212–217.
Fußnoten
- Siehe dazu v.a. den Briefwechsel mit seinem Schüler Ernst-Rudolf Huber und die Detaillierte Schilderung bei Mehring: Carl Schmitt, S. 304–436.
- Vgl. dazu immer noch Breuer: Anatomie der Konservativen Revolution.
- Ernst Jünger – Carl Schmitt. Briefwechsel, Stuttgart 1999, S. 7.
- Vgl. Thoma: Zur Ideologie des Parlamentarismus.
- Heller: Politische Demokratie und soziale Homogenität, S. 424 f.
- Siehe Sternberger: Begriff des Politischen.
- Vgl. Mouffe: Über das Politische.
Der Autor:
Privatdozent Dr. Jens Hacke vertritt derzeit den Inhaber des Lehrstuhls für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Greifswald. 2018 erschien im Suhrkamp-Verlag seine ideengeschichtliche Studie „Existenzkrise der Demokratie. Zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit“.
Veröffentlicht: 27. März 2019