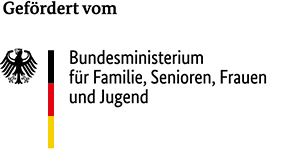Verluste bei den Landtagswahlen: Ist die AfD Geschichte?

Die AfD musste bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erneut deutliche Verluste hinnehmen. Damit bestätigt sich ein Trend in den Umfragen auf Bundesebene. Ist der Höhenflug der AfD vorbei?
Die AfD erzielte in Baden-Württemberg 9,7 Prozent (-5,4) und in Rheinland-Pfalz 8,3 Prozent (-4,3). Umfragen zu den Wahlmotiven zeigen, dass die AfD weiterhin eine monothematische Partei ist. Sie hat es nicht geschafft, über die Frage der Begrenzung von Zuwanderung hinaus ein politisches Profil zu entwickeln. 83 Prozent der AfD-Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg sehen die Kompetenzen ihrer Partei bei der Kriminalitätsbekämpfung, 81 Prozent in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Man kann davon ausgehen, dass die Wählerschaft der AfD die beiden Themen Kriminalität und Zuwanderung als einen weitgehend miteinander verknüpften Komplex ansieht.
Corona spielt keine Rolle
Unter den AfD-Wählern stimmten in Rheinland-Pfalz 99 Prozent und in Baden-Württemberg 91 Prozent der Aussage zu: „Finde es gut, dass sie den Zuzug von Ausländern und Flüchtlingen begrenzen will“. Erstaunlicherweise spielte das Thema Corona-Politik unter den AfD-Wählern in beiden Bundesländern keine Rolle – im Gegensatz zu den Wählern der anderen Parteien, wo die Bekämpfung der Pandemie zumindest als ein nachrangiges Thema unter den Wahlmotiven auftaucht.
Kontinuierlicher Abwärtstrend für die AfD
Seit 2015 ist das Thema Flüchtlingspolitik wieder etwas in den Hintergrund getreten. Es ist deshalb verständlich, dass eine Partei, die sich derart auf dieses Thema fokussiert, an Zustimmung verliert. Dies zeigt sich symptomatisch an Wahlergebnissen der Partei in Baden-Württemberg, wo die Partei sich seit ihrem Rekordergebnis bei den Landtagswahlen 2015 auf der Höhe der Flüchtlingskrise bei den folgenden Bundestags‑, Europa- und nun wieder Landtagswahlen in einem kontinuierlichen Abwärtstrend befindet.
Rechtsextreme Radikalisierung wird zum Problem der AfD
Ein weiteres Problem der Partei ist ihre zunehmende Radikalisierung. In Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz stimmten 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Aussage zu, die AfD distanziere sich nicht ausreichend von rechtsextremen Positionen. 70 Prozent gaben in beiden Bundesländern an, sie empfänden die Partei als undemokratisch und verfassungsfeindlich. Hier wirkt offensichtlich bereits das Verdikt des Bundesverfassungsschutzes. Der hatte die Partei Anfang März zum Verdachtsfall erklärt.
Beobachtung durch den Verfassungsschutz schadet im bürgerlichen Lager
Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz folgt der zunehmenden Kontrolle der Partei durch den rechtsextremen „Flügel“ um Rechtsaußen Björn Höcke. Auch wenn der „Flügel“ sich im vergangenen Jahr formell auflöste, ist das Netzwerk weiterhin einflussreich. Die Strategie von Björn Höcke und seinem Spindoktor Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik, die Partei stärker völkisch auszurichten und klarer in Richtung einer Systemopposition zu lenken, hat zu Verlusten von Wählern in bürgerlichen Kreisen geführt. Die AfD ist durch die antidemokratische Radikalisierung für enttäuschte CDU-Wähler und wirtschaftsliberale Euro-Kritiker immer weniger wählbar geworden. Der Co-Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, versuchte zwar zuletzt, durch einen parteiinternen Machtkampf mit dem Flügel – etwa durch den Parteiausschluss des Höcke-Vertrauten und ehemaligen Brandenburger Parteivorsitzenden Andreas Kalbitz – , die Beobachtung durch den Verfassungsschutz abzuwenden. Bislang muss sein Kurs aber als gescheitert gelten.
AfD als Anti-Eliten-Partei
Ist die AfD deshalb nun Geschichte? Solch eine Schlussfolgerung wäre verfrüht. 10 Prozent bei den Landtagswahlen sind immer noch ein beachtliches Ergebnis. In Baden-Württemberg liegt die Partei nahezu gleich auf mit der SPD und FDP. In Rheinland-Pfalz liegt sie nur einen Prozentpunkt hinter den Grünen und deutlich vor der FDP. Zudem etabliert sich die AfD zunehmend als Partei der kleinen Leute gegen „die da oben“. Das könnte auch bei der Bundestagswahl, bei der die Corona-Pandemie möglicherweise eine größere Bedeutung spielen wird, auszahlen. Die Umfragen zu den Motiven der Querdenker-Proteste haben deutlich gezeigt, dass dies eine Anti-Elitenbewegung ist. Die AfD könnte hier erfolgreich andocken.
Soziale Fragen und Zustimmung in der Arbeiterschaft
Denn eine weitere Kompetenzzuschreibung der AfD-Wähler für ihre Partei zeigt sich bei der Frage sozialer Gerechtigkeit. In Baden-Württemberg sahen 57 Prozent der AfD-Wähler und in Rheinland-Pfalz immerhin 62 Prozent hier eine Kernkompetenz ihrer Partei. In Baden-Württemberg ist die AfD die Partei der Arbeiter. Mit 26 Prozent liegt sie in dieser Wählergruppe noch vor der CDU (23 Prozent) und Grünen (20 Prozent). Die SPD, die hier mit 10 Prozent weit abgeschlagen ist, konnte in Rheinland-Pfalz vom Amtsbonus von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) profitieren. Sie gewann hier 36 der Arbeiterschaft für die Sozialdemokraten. Aber auch hier stellen die Arbeiter die größte soziologische Gruppe innerhalb der AfD-Wählerschaft dar. 18 Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter entschieden sich für die AfD.
Man muss mit er AfD weiter rechnen
Dass die AfD die Partei gegen die „abgehobene Eliten“ ist, zeigt sich auch an der Zustimmung von 90 Prozent ihrer Wähler in Rheinland-Pfalz und 91 Prozent in Baden-Württemberg zu der Aussage, die AfD sei „näher an den Sorgen der Bürger als andere Parteien“. Die Partei steht damit wie die Querdenker symptomatisch für den Vertrauensverlust in Teilen der Bevölkerung, den demokratische Parteien und Institutionen zu beklagen haben. Insofern wird man mit der AfD auch in Zukunft rechnen müssen. Möglicherweise wird sie auf Bundesebene und in Westdeutschland nicht die systemkritische Relevanz erreichen können, wie sie das in ostdeutschen Landtagen kann. Aber für die liberale Demokratie der Bundesrepublik bleibt die AfD ein Menetekel für einen Vertrauensverlust in das demokratische System, den die politischen Verantwortlichen nicht ignorieren sollten und der bei krisenhaften Verschärfungen ein kritisches Ausmaß entwickeln kann. Auch wenn die Pandemie in diesem Jahr eingedämmt werden sollte, zeigt sich, dass die Zeichen der weltweiten Entwicklungen in einer globalisierten Welt nicht unbedingt auf Beruhigung stehen.
Die zitierten und weiter Umfrageergebnisse von dimap finden Sie auf der Website der ARD Tagesschau.
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.