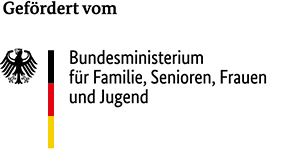Im Namen des Volkes gegen die Demokratie

Rechtspopulisten beanspruchen für sich, die „echten“ Demokraten zu sein. Solange diese Selbstbeschreibung bei einem Großteil der Wähler auf fruchtbaren Boden fällt, werden die gegen den klassischen Rechtsextremismus entwickelten Gegenstrategien wenig ausrichten.
Vor einigen Jahren titelte der Dramaturg Bernd Stegemann in Abwandlung von Karl Marx und Friedrich Engels, dass ein Gespenst umgehe in Europa—das Gespenst des Populismus. Und in der Tat stellen Wissenschaftler und politische Beobachter mit Erstaunen und Unbehagen fest, dass der Erfolg rechtspopulistischer Parteien trotz aller Gegenmaßnahmen zwar hier und da stagniert, aber insgesamt seit Jahren nicht abreißt. In Europa sind die traditionellen rechtspopulistischen Parteien trotz rückläufiger Wahlergebnisse nicht aus den Parteiensystemen verschwunden. Selbst in Deutschland, das aufgrund seiner Geschichte als besonders sensibilisiert gegenüber der Gefahr der radikalen Rechten gilt, hat es mit der AfD erstmals seit 1949 eine Partei rechts der Union in alle Landtage und den Bundestag geschafft.
Es verwundert nicht, dass seitens der anderen Parteien vermehrt über Strategien nachgedacht wird, mit denen man den Rechtspopulisten begegnen kann. [1] Drei Dinge sind diesen Strategien gemein. Erstens besteht das Ziel darin, die auf die Rechtspopulisten abgegebenen Stimmen zu verringern, und sie müssen sich daran messen lassen, inwieweit sie zum Erreichen dieses Ziels beitragen. Zweitens setzen sie an der Ideologie dieser Parteien an. Diese besteht aus einem oftmals rassistischen Menschenbild, auf dessen Grundlage rechtspopulistische Parteien ihre Forderungen gerade in der Migrationspolitik vorbringen. Zum anderen rekurriert diese Strategie auf die antidemokratische Gesinnung, die diese Parteien auszumachen scheint. Daher verwundert es drittens nicht, dass die gewählten Gegenmittel gerade in Deutschland meist auf Stigmatisierung und Dämonisierung abzielen. Bereits 2013, als die AfD noch relativ moderat und eher konservativ und euroskeptisch auftrat, galt sie einigen Beobachtern bereits als rechtspopulistische Partei. [2] Mithin ähneln die Reaktionen daher auch jenen des klassischen Antifaschismus, mit dem man auch extremen Vertreterinnen wie NPD und DVU begegnete.
Auch, wenn die Rechtspopulisten — wie nahezu alle Oppositionsparteien — während der Coronakrise ins Hintertreffen geraten, so hat sich zuvor gezeigt, dass die Gegenreaktionen gegen Rechtsaußen von unterschiedlichem Erfolg gekrönt sind. Eine „one size fits all“-Strategie gibt es nicht, und punktuelle Fortschritte sind oftmals darauf zurückzuführen, dass die Rechtspopulisten über ihre eigenen Fehler stolperten, wie etwa die Freiheitliche Partei Österreichs in der Ibiza-Affäre. Auf der anderen Seite zeigen zahlreiche empirische Studien, dass sich der Erfolg rechtspopulistischer Parteien durch zwei Einstellungsmerkmale ihrer Wähler erklären lässt: erstens die Übereinstimmung mit deren restriktiver Migrationspolitik und zweitens durch Zustimmung zu populistischen Demokratiekonzeptionen.
Da die Rechtspopulisten hauptsächlich das Migrationsthema lautstark bespielen, ist es nicht verwunderlich, dass die anderen Parteien auch genau darauf reagieren. Die Tatsache, dass sie mit ihren Wählern aber auch im Populismus übereinstimmen, sollte nachdenklich stimmen. Denn es bedeutet, dass Wähler und Parteien eine bestimmte Sicht auf das Gemeinwesen teilen. Nach der Populismus-Definition von Cas Mudde [3] besteht sie zum einen darin, im Volk eine politisch homogene Willensgemeinschaft zu sehen. Zum anderen porträtiert sie das politische Establishment als abgehoben, korrupt, egoistisch und unterstellt Desinteresse gegenüber den Interessen des Volkes. Damit sind nicht nur die Etablierten als Akteure adressiert, sondern auch die demokratischen Strukturen, innerhalb derer sie handeln. Dass etwa die polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ihre Politik mit dem „Willen des Volkes“ begründet, der „über dem Recht“ stehe, bekommt dadurch eine inhaltliche Dimension. [4]
Oft hat man Populismus als Stilmittel abgetan oder als eine Art „Extremismus light“ verstanden. Dabei zeigen aber sowohl die politische Psychologie als auch die Parteienforschung, dass Populismus tatsächlich eine substanzielle Einstellung zur Demokratie ist. Für Populisten ist allein die Umsetzung des reinen Volkswillens — den sie selbst zu kennen glauben — „demokratisch“. Sie negieren Partikularinteressen nicht nur, sondern schließen auch jene, die sie vertreten, aus ihrem Volksbegriff aus. Jede Form des Populismus ist damit mehr oder weniger antipluralistisch. Welche Gruppen das sind, hängt aber davon ab, ob es sich um „inklusive“ oder „exklusive“ Spielarten handelt [5]; Typen, die sich grob mit „links“ und „rechts“ übersetzen lassen. Lateinamerikanische Bewegungen oder die spanische Podemos zählen zum linken, AfD, FPÖ oder die französische Rassemblement National zu prominenten Vertreterinnen des rechten Typus.
Im Gegensatz zu den faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit oder ihren neofaschistischen Nachfolgern wie etwa der NPD lehnen Rechtspopulisten die Demokratie nicht offen ab. Sie formulieren kein alternatives Staatsmodell. Vielmehr gerieren sie sich als eigentliche Verteidiger „echter“ Demokratie, die darin besteht, dass der Volkswille auch gegen Widerstände durchgesetzt werden müsse. Neben Partikularinteressen sind dies auch institutionelle Beschränkungen, also jene checks and balances, die eine „Diktatur der Mehrheit“ verhindern sollen. Populismus adressiert damit ein demokratisches Paradoxon, das darin besteht, dass die Souveränität des Volkes rechtsstaatlich beschränkt werden muss, um die Demokratie zu bewahren [6].
Der erste Schritt besteht darin, zu untersuchen, was den Populismus jener Parteien, die wir als rechtspopulistisch bezeichnen, eigentlich ausmacht. Dafür lohnt es sich, ihre Wahlprogramme zu betrachten, denn aus ihnen lässt sich die Substanz dieser Parteien ablesen. [7] In der Tat stellt sich die rechtspopulistische Parteienfamilie in Westeuropa als relativ heterogen dar. Gemessen an der Salienz entsprechender Framings in ihren Wahlprogrammen sind nicht alle rechtsradikalen Parteien in gleichem Maße populistisch. Ein interessantes Beispiel ist die Dänische Volkspartei (DF). Ihre Programme enthalten einen starken, auf die dänische Kultur bezogenen Volksbegriff, aber kaum Anti-Establishment-Elemente, was auch vor dem Hintergrund interessant ist, dass die DF in unserem Untersuchungszeitraum konservative Minderheitsregierungen tolerierte. Gleichzeitig besteht insgesamt ein Zusammenhang zwischen der Bedeutung der Anti-Establishment-Haltung im Wahlprogramm und der ideologischen Ausrichtung: je weiter rechts die Partei gesellschaftspolitisch steht, desto klarer grenzt sie sich von „denen da oben“ ab. Ähnliches gilt für die Anti-Establishment-Haltung wirtschaftsliberaler Parteien im rechtspopulistischen Spektrum, wie etwa der Schweizerischen Volkspartei (SVP). [8] Beides ist nicht überraschend: im ersten Fall wird das politische Establishment für kulturelle Spannungen verantwortlich gemacht; im zweiten wird wirtschaftlicher Liberalismus auf vermeintlich inkompetente Eliten reduziert, die dem fleißigen Bürger in die Tasche greifen. In beiden Fällen geht es nicht um die Abschaffung der Demokratie, sondern darum, die Eliten pauschal zu Schuldigen politischer Probleme zu erklären.
Hinsichtlich des „Volkes“ lassen sich unterschiedliche, miteinander verbundene Muster erkennen. Auf der einen Seite steht ein Volksbegriff, der sich um die jeweilige nationale Kultur bzw. Identität entspinnt. Er prägt die meisten Wahlprogramme, was mit Blick auf die Ideologie dieser Parteien nicht überraschend ist. Auf der anderen Seite betonen sie die politische Souveränität des Volkes. Gerade in der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise rückte dieser Aspekt stärker in den Vordergrund. Beiden Varianten ist gemein, dass sie von den Rechtspopulisten als prekär beschrieben werden. Wird die Identität durch die gesellschaftlichen Entwicklungen der Postmoderne bedroht, so fällt die Souveränität nicht nur den „abgehobenen Eliten“ im Nationalstaat, sondern auch der Europäischen Union zum Opfer, die den Rechtspopulisten als totalitäres System gilt. Jene „da oben“ — ob innerhalb eines Gemeinwesens oder in Gestalt der „Brüsseler Technokraten“ — sind demnach jene Feinde, gegen die die Populisten von rechts außen die „wahre Demokratie“ zu verteidigen suchen. Sind die Rechtspopulisten selbst an der Regierung, wenden sie sich gerade dann verstärkt der EU zu — die ungarische Regierung unter Viktor Orbán ist das prominenteste Beispiel.
Diese Befunde machen deutlich, worin das Problem der etablierten Parteien besteht: Solange die Rechtspopulisten für sich beanspruchen können, selbst die „echten“ Demokraten zu sein und diese Selbstbeschreibung bei einem Großteil der Wähler auf fruchtbaren Boden fällt, werden die gegen den klassischen Rechtsextremismus entwickelten Gegenstrategien wohl wenig ausrichten — selbst dann nicht, wenn die modernen Rechtspopulisten tatsächlich auch Faschisten in ihren Reihen beherbergen. Um Strategien im Umgang mit rechtspopulistischen Parteien zu entwickeln, genügt es also nicht, allein auf ihre rechtsradikalen Positionen abzustellen. Wenn diese Parteien nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer populistischen Agenda gewählt werden; wenn sie ihren Wählern erfolgreich glaubhaft machen, die „wahren Demokraten“ im Land zu sein, dann sollten zukünftige Strategien diesen Aspekt stärker in den Blick nehmen. Es reicht dabei auch nicht aus, auf die extremsten Vertreter dieser Parteien zu zeigen — in der AfD etwa Björn Höcke. Denn diese segeln praktisch im Windschatten von Parteien mit, die von sich behaupten, nicht den Faschismus, sondern die Demokratie wiederherstellen zu wollen und damit auch noch an der Wahlurne Erfolg haben. Die Frage ist also nicht, ob man die Herausforderer dämonisiert oder nicht, sondern wie es gelingen kann, jene latente Kampfgemeinschaft für die illiberale Demokratie zwischen ihnen und ihren Wählern zu kappen. Zu der Hoffnung, dass verlorenes Vertrauen zwischen Bürgern und Politik zumindest teilweise wiederhergestellt werden kann, geben die sinkenden Umfragewerte für die Rechtpopulisten in der Corona-Krise Anlass.
Dr. Marcel Lewandowsky ist Politikwissenschaftler und hat eine DAAD-Gastdozentur an der University of Florida inne.
Dr. Simon Franzmann ist Politikwissenschaftler und Inhaber der Professur Politisches System der Bundesrepublik Deutschland an der Universität Siegen.
Die Autoren sind Verfasser der kürzlich erschienenen Studie „Populismus? Populismen! Programmatische Heterogenität rechtspopulistischer Parteien in Westeuropa“, die hier heruntergeladen werden kann.
Fußnoten
[1] Vgl. bspw. Anna-Sophie Heinze: Streit um demokratischen Konsens – Herausforderungen und Grenzen beim parlamentarischen Umgang mit der AfD. In: Cathleen Bochmann und Helge Döring (Hrsg.): Gesellschaftlichen Zusammenhalt gestalten. Wiesbaden 2020, S. 121–135.
[2] Vgl. Marcel Lewandowsky: Eine rechtspopulistische Protestpartei? Die AfD in der öffentlichen und politikwissenschaftlichen Debatte. In: Zeitschrift für Politikwissenschaft 25 (1) 2015, S. 121–135.
[3] Vgl. Cas Mudde: The Populist Zeitgeist. In: Government and Opposition 39 (3) 2004, S. 541–563.
[4] Deutschlandfunk: Soziologe: „Das politische Leben wird zum Boxring“. 27. November 2015. https://www.deutschlandfunk.de/polens-neue-regierung-soziologe-das-politische-leben-wird.694.de.html.
[5] Vgl. Cas Mudde und Cristóbal Rovira Kaltwasser: Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America. In: Government and Opposition 48 (2) 2013, S. 147–174.
[6] Vgl. Yves Mény und Yves Surel, The Constitutive Ambiguity of Populism. In: Dies. (Hrsg.): Democracies and the Populist Challenge. London 2002, S. 1–21.
[7] Wir beziehen uns hier auf einen von uns erhobenen Datensatz, der die Wahlprogramme rechtspopulistischer Parteien in Westeuropa (sowie das der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung) zwischen 2000 und 2017 umfasst. Vgl. Simon T. Franzmann und Marcel Lewandowsky: Populismus? Populismen! Programmatische Heterogenität rechtspopulistischer Parteien in Westeuropa. Bonn 2020.
[8] Vgl. ebd., S. 33.