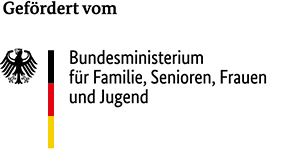„Man wird doch wohl noch sagen dürfen?“ – Die bedrohte Meinungsfreiheit als Papiertiger

Rechtsextreme Agitatoren beklagen ein Demokratiedefizit und die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Dabei geht es ihnen im Kern darum, die Grundregeln unseres demokratischen Zusammenlebens fundamental infrage zu stellen.
Die rechtsextreme Rhetorik ist voll von einem Geraune darüber, dass die Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik bedroht sei. Fast jede politische Diskussion, in der es um Kritik an Antisemitismus, Rassismus oder Antifeminismus geht, wird von rechter Seite abgewehrt mit dem Verweis auf die Meinungsfreiheit: „Man wird doch wohl noch sagen dürfen?“. Wenn man einen empirischen Blick auf diese Debatten wirft, stellt man fest, dass auf die floskelhafte Bezugnahme auf die Meinungsfreiheit stets die Artikulation all jener Ressentiments folgt, von denen unterstellt wird, man dürfe sie öffentlich nicht äußern. So entsteht die Paradoxie, dass unter dem Ticket einer angeblich bedrohten Meinungsfreiheit unzählige Positionierungen in der öffentlichen Debatte mehr und mehr Raum einnehmen, die sich gegen fundamentale Prinzipien der Demokratie richten, etwa gegen die Unantastbarkeit der Menschenwürde (Art. 1 GG) oder das Gleichheitsgebot und Diskriminierungsverbot (Art. 3 GG). Meinungsfreiheit ist aber ein grundgesetzliches Abwehrrecht, so dass fast alle „Debatten“, die die extreme Rechte zu diesem Thema anzettelt, rein gar nichts mit Fragen der Meinungsfreiheit zu tun haben. Sie ist ein rhetorisches Ticket, um die Demokratie zu delegitimieren und zu destabilisieren.
Es geht den rechtsextremen Agitator/innen grundsätzlich nicht um Debatten mit dem Ziel des Austausches von gleichberechtigten Positionen, bei der alle prinzipiell bereit wären, sich durch (bessere) Argumente überzeugen zu lassen – es geht um emotionale Überwältigung, die sich für Fakten nicht interessiert und sie, wenn überhaupt, nur instrumentell einsetzt. Diesen Kampf gegen die Demokratie führen die völkischen Rebell/innen als fanatische Dauerwahlkämpfer/innen. Sie leben von einem selbstinszenierten und hoch emotionalisierten Dauerwahlkampf – der nur in seiner Unsachlichkeit, Unseriosität und Emotionalität erfolgreich sein kann, weil die Beschleunigung, die der Wahlkampfmodus bietet, Verstand und Vernunft suspendiert und Fakten und Wissen alleinig dem affektiven Willen zur Macht untergeordnet werden.
Dieser Modus des Dauerwahlkampfes, der auch und gerade in den Arenen des Internets geführt wird, ist ein Kampf um kulturelle Hegemonie für völkische Positionen, der als Kampf um Meinungsfreiheit getarnt wird – aufgrund des Verschwörungsglaubens in der rechten Szene bisweilen auch in dem tatsächlichen Glauben, es würde eine ungerechtfertigte Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland geben, wie es etwa der rechte Kampfbegriff der Political Correctness dokumentiert. Dass es sich dabei um ein falsches, weil ausschließlich instrumentelles Verständnis von Meinungsfreiheit handelt, bei dem lediglich antidemokratische und antipluralistische Positionen wieder salonfähig gemacht werden sollen, ignoriert, dass es Kern einer Demokratie ist, die politischen und rechtlichen Grenzen des Sagbaren zu definieren, um ihren eigenen Bestand zu garantieren.
Angesichts der maßgeblich durch die Digitalisierung bedingten Beschleunigung des Alltags in Demokratien am Beginn des 21. Jahrhunderts stehen politische Akteurinnen und Akteure in der Öffentlichkeit unter einem gefühlten Druck, schnell und pointiert auf Ereignisse reagieren zu müssen – und zwar Akteurinnen und Akteure aller politischen Parteien, also nicht nur derjenigen, die den Modus des emotionalisierten Dauerwahlkampfes für sich reklamieren. Insofern ist nicht die Form der damit verbundenen Artikulation (der Populismus) zentral, sondern der auf diesem Weg transportierte Inhalt; die Frage danach, welche Ziele angestrebt werden und ob diese demokratisch oder antidemokratisch sind. Das Verständnis von Demokratie sollte dabei nicht auf eine rein formale Dimension verkürzt werden, der zufolge ein System als demokratisch gilt, allein weil es Wahlen gibt. Bei der Beurteilung, ob politische Inhalte demokratisch oder antidemokratisch sind, ist die Frage nach dem Wesenskern von Demokratie bedeutsam.
Der verfassungsrechtliche Minimalkonsens basiert auf dem Verständnis des Verhältnisses von dēmos (griech.; Volk/smasse) und krateĩn (griech.; herrschen). Die meisten europäischen Demokratien beantworten beide Elemente so, dass ein völkisches Volksverständnis abgelehnt wird und dass die Herrschaft auf repräsentativem Weg erfolgt. Das heißt aber auch, dass eine Demokratie, die sich wie beispielsweise die bundesdeutsche als „wehrhaft“ versteht, nicht so naiv sein darf zu glauben, man müsste rechtsextremen Forderungen allein, weil sie existieren, Gehör schenken – geschweige denn ihnen folgen. Denn nicht, wer am lautesten schreit, darf sich durchsetzen, sondern nur, wer auf repräsentativem Weg Mehrheiten erlangt. Genau deshalb muss eine wehrhafte Demokratie antidemokratische Positionen ausgrenzen, weil diese gegen den substanziellen Kern der Demokratie verstoßen und sie faktisch abschaffen wollen.
Damit verbunden ist die Schlüsselfrage, ob Populismus auf Demokratiedefizite – seien es formale und/oder inhaltliche – hinweist. Mit Blick auf formale Defizite, also etwa in Verfahrensfragen, ist festzuhalten, dass es allein noch kein prozeduraler Mangel ist, wenn Menschen nicht willens oder in der Lage sind, im demokratischen Rahmen zu partizipieren. Es zeigt nur, dass bei denen, die nicht wissen, wie sie umfangreich partizipieren könnten, ein zu geringes Maß an Kompetenz und damit an politischer Bildung zu attestieren ist. Wenn es aber tatsächlich prozedurale Mängel in den westlichen Demokratien geben sollte (was ja sein kann), dann müsste man sie klar und rational benennen können – die rechten Agitatorinnen und Agitatoren haben dies noch nie getan. Auch wenn rechte Parteien mittlerweile (wieder) Wahlerfolge erzielen, geht es ihnen im Kern nicht darum, durch konstruktive Arbeit Mehrheiten zu erzielen, sondern darum, Wege zu finden, um ihre egoistischen Partikularinteressen durchzusetzen. Es geht ihnen eben nicht um den realen Willen des Volkes, sondern um den unterstellten (und erlogenen) Volkswillen – nicht um das, was empirisch prüfbar und wirklich vorhanden ist, sondern um das, was Rechte zum „Volkswillen“ erklären: ihre eigene völkische Weltsicht. Im Kern geht es bei dem antiparlamentarischen Affekt der populistisch agierenden extremen Rechten um das, was in der Weimarer Republik schon der Staatsrechtler Carl Schmitt – als einer der zentralen Wegbereiter des Nationalsozialismus – forderte: eine gelenkte Demokratie auf der Basis eines erfühlten (das heißt von den Rechten diktierten) „Volkswillens“, der auf ethnischer Homogenität und einem kategorialen und militarisierten Freund-Feind-Denken basiert.
Im Gegensatz dazu wird über Fragen nach inhaltlichen Defiziten in einer parlamentarischen, repräsentativen Demokratie pluralistisch (mit immer wieder wechselnden Mehrheiten) gestritten. Es gibt einen pluralistischen Grundkonsens, den die extreme Rechte fundamental infrage stellt; deshalb sind deren Forderungen auch inhaltlich antidemokratisch und formal demokratiefern. Als Demokrat/in, die/der die Verfassung als Minimalkonsens und das Prinzip des Pluralismus mit seinen Facetten der Ablehnung völkischen Denkens einschließlich jeder Form von Essentialismus vertritt, muss man deshalb klar sagen, dass rechtsextreme Populist/innen auch nicht auf inhaltliche Defizite hinweisen, sondern vielmehr diesen demokratischen Grundkonsens zerstören wollen, der da lautet: Man darf uneinig sein – aber eben nicht auf einer beliebigen Grundlage, da Demokratie eine Herrschaftsform ist, die darüber entscheiden muss, wer ihre Grundregeln verletzt.
Uneinigkeit basiert auf dem Prinzip des politischen und gesellschaftlichen Pluralismus. Wer diesen nicht anerkennt – und dazu gehört jede Form völkischer Homogenitätsfantasien, wie sie im völkischen Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus oder Antifeminismus zum Ausdruck kommen – verlässt diese Grundlage von Freiheit und Gleichheit. Deshalb sind die Forderungen rechtsextremer Populist/innen weder formal noch inhaltlich geeignet, tatsächliche Demokratiedefizite zu benennen oder gar zu beheben; die Demokratie muss, um ihrer selbst willen, diese Forderungen konsequent ausgrenzen und – mehr noch – rechtsextreme Populist/innen als das bekämpfen, was sie sind: nicht einfach Gegner, sondern Feinde der Demokratie. Wer aber solche Positionen auf öffentliche Podien wie Fernseh-Talkshows hebt, trägt nicht zu mehr Pluralismus bei, sondern dazu, dass diejenigen, die diesen Pluralismus abschaffen wollen, auch noch mit seinen Mitteln gegen ihn kämpfen können.
Eine ausführlichere Fassung des Beitrags ist erschienen im „Jahrbuch für Antisemitismusforschung“ Bd. 27 (2018).
Samuel Salzborn lehrt Politikwissenschaft an der Universität Gießen. Anfang März erscheint sein neues Buch „Kollektive Unschuld. Die Abwehr der Shoah im deutschen Erinnern“ bei Hentrich & Hentrich.