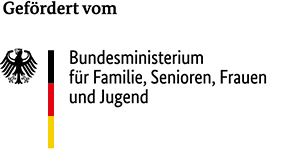Monika Maron: Angst vor Überfremdung

In den letzten Jahren warnte Monika Maron immer wieder vor einer Islamisierung durch Zuwanderung. Gleichzeitig sieht sie sich übermächtigen Meinungskontrolleuren eines linken Mainstreams ausgesetzt. Ihre jüngste Essay-Sammlung veröffentlichte die Schriftstellerin im Verlag des Dresdner Kulturhaus Loschwitz von Susanne Dagen, einem kulturellen Sammelpunkt für Rechtsintellektuelle. Wie ist es zu dieser Annäherung gekommen? Und wie spiegelt sie sich im Werk von Monika Maron wider?
Am 4. Januar 2015 veröffentlichte die Schriftstellerin Monika Maron in der Tageszeitung „Die Welt“ einen Bericht über einen vorweihnachtlichen Besuch in Dresden. Maron hatte an einer Demonstration der „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ (PEGIDA) teilgenommen. Die Bewegung befand sich eben zum Jahreswechsel 2014/15 auf einem ersten Höhepunkt ihrer Popularität, begleitet von einer aufgebrachten medialen Debatte. Maron, bekannt nicht nur als Romanautorin, sondern auch als politische Intellektuelle mit Freude an Provokation, verteidigte die Demonstranten. Keineswegs handle es sich vorwiegend um Neonazis, vielmehr um Bürger, deren Anliegen demokratisch legitim seien: „Nimmt man die Pegida-Anhänger beim Wort, dann halten sie es für unsere und ihre Pflicht, Kriegsflüchtlinge und politisch Verfolgte aufzunehmen, abgelehnte Asylbewerber aber abzuschieben, und sie fordern eine gesetzlich geregelte Einwanderung.“[1] Es gelte, sie nicht zu diffamieren, sondern mit ihnen in eine „offene Diskussion“[2] einzutreten.
So berechtigt Marons Forderung war, die Demonstranten nicht pauschal zu verdammen, so beschränkt war auch ihr eigener Blick. Sie ignorierte in ihrer Schuldzuweisung an Politik und Medien, dass die PEGIDA-Anführer selbst es waren, die ihren Anhängern verboten hatten, mit der „Lügenpresse“ oder politischen Gegnern zu sprechen oder zusammenzuarbeiten. Der eigennützige Plan von Lutz Bachmann war es offenkundig von Anfang an, die Menschen in eine Fundamentalopposition zum bundesdeutschen „System“ zu treiben. Maron verbot es sich aber selbst, die Absichten der Anführer kritisch zu hinterfragen: „Ob sie das wirklich so meinen, kann und will ich nicht beurteilen.“[3] Die Radikalisierung der Bewegung, die sich trotz allem Dialog vollzog, ist bekannt: Agitation gegen muslimische „Invasoren“, „Absaufen“-Sprechchöre gegen Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, Affengebrüll gegen schwarze Menschen. PEGIDA trug zu einer Veränderung der politischen Kultur in Deutschland bei, in deren Folge es zu Brand- und Bombenanschlägen gegen Flüchtlingsheime, Moscheen und Treffpunkte politischer Gegner kam.
Wieso forderte eine Autorin, die in ihren eigenen Polemiken, etwa gegen ostdeutsche Lehrer, PDS-Wähler oder sozialistische Utopisten, auch nicht immer feinfühlig und ausgewogen urteilte, gerade für die „Patrioten“ eine möglichst differenzierte, ja wohlwollende Betrachtung ein? Wieso entdeckte sie bei PEGIDA nicht auch jene illiberale und antiwestliche „Angst vor der Marktwirtschaft, Angst vor Drogen und Aids, Angst vor Ausländern, Angst vor der Zukunft und dem Phantom der Freiheit“[4] wieder, die sie selbst 1990 einem Teil der Ostdeutschen kritisch attestiert hatte? Wieso störte sich die 1988 aus der DDR in den Westen Übergesiedelte nicht an der bei PEGIDA allgegenwärtigen Agitation gegen „Wirtschaftsflüchtlinge“, nachdem sie 1989 noch jene Ostdeutschen, die „wirtschaftliche Gründe […] zur Flucht bewogen haben“ [5], verteidigt hatte?
Der Erfolg von PEGIDA, den sich inzwischen die AfD angeeignet hat, beruhte auf ihrer Anziehungskraft für Unzufriedene ganz verschiedener Art. Während einige besonders die Forderung nach „Frieden mit Russland“ anzog, andere eher die Abrechnung mit der Arroganz westdeutscher „Eliten“, fesselte wieder andere vor allem das Versprechen eines Kampfes gegen die „Islamisierung“ – so auch Monika Maron:
Islamisierung beginnt nicht erst, wenn der Islam in Deutschland Staatsreligion geworden ist, sondern wenn er unsere rechtsstaatlichen und zivilisatorischen Grundsätze mit seinen religiösen Ansprüchen unterläuft. Man muß kein Anhänger von Pegida sein, um zu fordern, dass Regierung und Gesellschaft die schwer erkämpfte Säkularität verteidigen und einer Religion, der die Aufklärung noch bevorsteht, klare Grenzen zu ziehen.[6]
Die Kritik am Islam, die Maron im vergangenen Jahrzehnt in zahlreichen Reden und Essays geäußert hat, speist sich ihrem eigenen Anspruch nach aus dem säkularen und universalistischen Geist der Aufklärung. Ihre Kritik gilt den
[…] deutschen und europäischen Propagandisten der Toleranz gegenüber der Intoleranz und der Gleichwertigkeit aller Kulturen, die in der Aufklärung offenbar nichts anderes sehen als einen neuen religionsähnlichen Fundamentalismus oder eine moderne Form des Kolonialismus. Kritik am Islam gleich Islamophobie gleich Rassismus – das ist die Formel, mit der sie die lebensnotwendige Auseinandersetzung zu ersticken versuchen.[7]
Maron sieht in der Debatte die politischen Vorzeichen ins Gegenteil verkehrt:
Wer die bis dahin selbstverständlichen Forderungen der Linken wie die Aufklärung, den säkularen Staat und die Frauenrechte verteidigte, fand sich plötzlich auf dem rechten Kampffeld wieder; und meine linken, grünen Feministinnen aus Hamburg verteidigten vermutlich leidenschaftlich das islamische Kopftuch und forderten Verständnis auch für die hartgesottensten muslimischen Frauenverächter, was für mich bedeutet: sie waren zu Reaktionärinnen mutiert, also rechts.[8]
Maron fordert hingegen ein Bündnis gerade mit den liberalen Muslimen und Ex-Muslimen ein, die für eine aufgeklärte, demokratische Gesellschaft eintreten:
Wir brauchen die Solidarität und Freundschaft aller, die für ein freiheitliches, säkulares Europa streiten, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Glauben. Unser Beistand gilt denen, die um eine Freiheit kämpfen müssen, die zu den Selbstverständlichkeiten unseres Lebens gehört und die wir zu verteidigen haben.[9]
Marons Position entspricht also programmatisch nicht der Islamfeindschaft von rechtsradikalen Agitatoren wie Götz Kubitschek und AfD-Politikern wie Björn Höcke, die – wie etwa der Historiker und Publizist Volker Weiß gezeigt hat[10] – den autoritären und patriarchalischen Islam durchaus bewundern, so lange er nur Europa fern bleibt. Diese völkischen Islamfeinde vertreten aus rechter Warte eben den anti-aufklärerischen Kulturrelativismus, dessen „linke“ Variante Maron – durchaus zurecht – ausdauernd geißelt.
Es stellt sich allerdings die Frage: Warum betont Maron selbst diesen Unterschied nicht? Ein Grund hierfür ist wohl, dass Marons Kritik am Islam eben doch oft ins Ressentiment kippt:
Die meisten Muslime sind friedlich, heisst es. Das stimmt. Und trotzdem frage ich mich seit einiger Zeit bei jeder Frau, die mir kopftuchbewehrt entgegenkommt: Was willst du mir damit sagen? Dass du anders bist als ich? Dass du besser bist als ich? Dass meine Enkeltochter eines Tages auch so rumlaufen wird? Das habe ich mich vor fünfzehn oder zwanzig Jahren, als die Kopftücher eher selten waren, noch nicht gefragt. Dass die meisten Muslime friedlich sind, ist keine Garantie für ihre freiheitliche oder gar säkulare Gesinnung.[11]
Das Kopftuch wird hier als militärische Panzerung imaginiert und als Zeichen der Aggression verstanden. Auf diese Weise wird doch jede Muslima zum potenziellen Feind erklärt. Als Kritik an Fundamentalismus oder politisierter Religion kann dieser Generalverdacht nicht mehr ausgegeben werden. Statt mit der Fremden ins Gespräch zu kommen, unterstellt ihr Maron aus der Ferne böse Absichten – eine verkniffene Aggressivität, die eher dem Klischeebild des ostdeutschen Provinzlers entspricht.
Solches Ressentiment verwundert ebenso wie die Selbststigmatisierung, mit der Monika Maron sich seit einiger Zeit als Tabubrecherin und Opfer von übermächtigen Meinungskontrolleuren inszeniert. Das Verfahren ist – nicht zuletzt als Strategie des Eigenmarketings – bekannt von Thilo Sarrazin. Maron fühlt sich von der bundesdeutschen Gegenwart inzwischen – ähnlich wie ihr Kollege Uwe Tellkamp – an DDR-Verhältnisse erinnert. Zwar ist sie sich der historischen Unterschiede bewusst, doch als Beleg bleibt das persönliche „Gefühl“[12] – gegen das rational kein Einspruch möglich ist. Maron scheint nicht aufzufallen, dass sie sich in solcher Pose bedenklich dem „Bild vom greinenden und gekränkten Ostdeutschen“ nähert, das sie selbst früher in Beiträgen wie Im Osten nichts als Opfer? verspottet hatte.[13]
Doch sind es nur Gefühle, die für Maron eine Brücke zum rechten Ufer bilden? Texte aus den vergangenen Jahren, in denen Kulturpessimismus und nationales Gemeinschaftsdenken sich verbinden, wecken Zweifel. So etwa die seltsame Rede zum Hölderlin-Preis aus dem Jahr 2003, in der Maron klagt:
Mich interessiert, warum jede öffentliche Angelegenheit nur noch als Geldangelegenheit verhandelt wird, warum jede Tradition, jede Einrichtung und jede Vereinbarung unter einen kurzfristigen Rentabilitätszwang geraten ist, warum und wie Wissen, Nähe, Fürsorge, Schönheit, Kunst unter der Messlatte des Geldes ihren eigenen Wert verloren haben.[14]
Diese Klage über die verderbliche Allmacht des Mammons überrascht aus dem Mund einer bekennenden FDP-Wählerin. Linke Gesellschaftskritiker dürften schmunzeln angesichts Marons Verwunderung darüber, dass in einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft alle Beziehungen dazu tendieren, sich in Verhältnisse des Warentauschs zu verwandeln. Maron stößt in ihrer Rede bei der Suche nach Schuldigen auf das „Diktat der globalen Wirtschaft“[15] und verwandelt ihren idealistischen Antikapitalismus so in einen nationalen. Rettung erhofft sie von einer „füreinander einstehenden Gemeinschaft“, in der die Bürger sich im Geiste des Gemeinwohls zusammenfinden, statt sich durch „degenerierte, unfähige Parteien“ regieren oder in „Minderheiten“ spalten zu lassen.[16] Unwillkürlich denkt man an die Warnung Ralf Dahrendorfs, gerade die Konfliktscheu und die Idee der Volksgemeinschaft speisten die illiberalen Sehnsüchte der Deutschen.[17]
Monika Maron, „Kind von Kommunisten“[18] und doch nach ihren biografischen Erfahrungen in der DDR strenge Antisozialistin, findet für den Protest gegen die in ihren Augen desolaten Verhältnisse offenbar keinen anderen Ausgangspunkt als den einer nationalen Opposition. Während sie als Fürsprecherin der Wiedervereinigung 1989/90 nach eigenem Bekunden noch mit dem nationalen Denken fremdelte, ist es inzwischen offenbar zur Prämisse ihrer politischen Weltanschauung geworden. Deswegen lehnt sie auch alle Vergleiche von ostdeutschen Flüchtlingen mit solchen aus anderen Ländern als „unlauter und absurd“[19] ab. Wenn Maron andernorts die angeblich unter Angela Merkel „sperrangelweit geöffneten Grenzen“ auch deswegen verurteilt, weil die „soziale Gerechtigkeit“ entscheidend durch die „illegal Eingewanderten“[20] bedroht werde, dann sind zumindest die ersten Schritte getan auf dem Weg zum „solidarische[n] Patriotismus“[21], den Björn Höcke zum Programm der AfD erhoben hat und zur Rehabilitation der nationalen „Souveränität“[22] im Namen des Sozialen bei Sahra Wagenknecht.
In Marons jüngstem Zeitroman Munin oder Chaos im Kopf (2018) gewinnen ihre politischen Äußerungen in der Figur der Icherzählerin literarische Gestalt. Die Protagonistin des Romans, die Journalistin Mina Funk, hat ähnlich unangenehme Begegnungen mit Kopftuchfrauen wie ihre Schöpferin:
Klopfte diese Angst nicht längst in meinem Kopf, wenn ich die abweisenden Gesichter der kopftuchtragenden Frauen sah, die sich selbst in unserer Gegend mit jedem Tag, wie mir schien, vermehrten; oder wenn ich ihren Männern auf dem Gehweg ausweichen musste, weil ich fürchtete, sie würden mich sonst über den Haufen rennen; oder wenn ich auf dem Spielplatz an der Ecke fast nur noch schwarzhaarige Kinder sah und mir ausmalte, wie die Stadt aussehen würde, wenn sie alle erwachsen wären und selbst wieder Kinder hätten? War es nicht so, dass die hunderte Millionen Söhne uns längst den Krieg erklärt hatten, und wir glaubten immer noch, sie ließen sich beschwichtigen oder wir könnten sie besiegen?[23]
Mina Funk fürchtet sich vor dem, was in der Sprache neurechter Agitation zurzeit als „Umvolkung“ bezeichnet wird. Wenn sie sich angesichts von Kriegen, Terroranschlägen und Verbrechen auch in Deutschland in einer „Vorkriegszeit“[24] wähnt, erinnert dies an den Kulturpessimismus im rechtsintellektuellen Lager. Mina Funks Befürchtung, die Deutschen seien inzwischen zu gutherzig und zu friedfertig, um den vermeintlichen Angriff des Islams zurückzuschlagen, entspricht der Warnung, die Botho Strauß in seiner Bekenntnisschrift Anschwellender Bocksgesang schon 1993 ausgesprochen hatte.[25] Verstärkt werden die Ängste der Journalistin noch dadurch, dass sie für einen Beitrag zu einer Festschrift die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges recherchiert und dabei viele Ähnlichkeiten mit der Gegenwart entdeckt. Ihr Beitrag wird – wie in Zeiten eingeschränkter Redefreiheit nicht anders zu erwarten – am Ende von den Herausgebern unterdrückt.
Die Handlung des Romans ist schmal. Erzählt wird von einer geistig verwirrten Frau, die vom Balkon ihrer Wohnung aus die Nachbarschaft mit unschönem, aber lautem Gesang stört. Statt sich gemeinsam gegen den Lärm zu wehren, zerstreiten sich die Nachbarn in zwei Lager. Die Partei der wohlhabenden Altbaubewohner plädiert mit besserwisserischer Moral für Menschlichkeit und rechtsstaatliche Normen. Die Mieter der Neubauwohnungen wollen die Sängerin hingegen mit fast allen Mitteln loswerden. Die Journalistin Mina Funk steht, obwohl eigentlich zur bürgerlichen Gesellschaft gehörig, auf der Seite der einfachen, aber ehrlichen Leute, die im Zeichen des Protests schwarz-rot-goldene Flaggen aus ihren Fenstern hängen und deutsche Volkslieder singen. Es ist keine allzu subtile Interpretation nötig, um diese Geschichte als allegorische Darstellung der „Flüchtlingskrise“ und der Rolle von Monika Maron in der politischen Debatte zu erkennen.
Einige Rezensionen legten nahe, man dürfe die Protagonistin des Romans nicht mit seiner Autorin verwechseln. Die Figur der geheimnisvollen, redenden Nebelkrähe Munin, bei der Mina Funk im Gespräch Trost findet, erfülle die Funktion, die Perspektive von Mona zur relativieren und so das Zustandekommen von Ressentiments vorzuführen. Das Buch erzähle von der Gefahr, diffusen Ängsten freien Lauf zu lassen, und hebe sich deshalb wohltuend von den ärgerlichen, stereotypen Äußerungen der Autorin ab.[26] Ob Autorin und Romanprotagonistin derart zu trennen sind, wird letztlich nur Monika Maron erklären können. Jedoch findet sich im Text wenig Anhalt für eine solche Deutung. Die Krähe Munin, die wohl so etwas wie die höhere Vernunft der Natur verkörpern soll, mildert die diffusen Ängste ihrer menschlichen Freundin nicht, sondern formuliert sie eher noch drastischer. Einige ihrer Ratschläge stammen aus dem Traditionsfundus des Sozialdarwinismus:
Das dümmste Tier weiß, dass es nicht mehr Nachkommen haben darf, als es ernähren kann. Ihr wisst das vielleicht auch, aber euer Menschsein hindert euch, die simpelsten Notwendigkeiten einzusehen. Und dann wundert ihr euch, wenn ihr immer wieder im Krieg landet.[27]
Auch die Erzählung als Ganze weckt kaum Zweifel an der Weltanschauung der Heldin oder konfrontiert sie mit glaubwürdigem Widerspruch. Die Befürchtungen bewahrheiten sich am Ende des Romans sogar, als in der Nachbarschaft kolportiert wird, zwei Männer von „südländische[m] Typ“[28] hätten versucht, eine Frau zu vergewaltigen und dabei ihren kleinen Hund ermordet. Mina Funk fühlt sich einmal mehr in ihrem Wunsch bestätigt, die „Millionen“ von „jungen Männern“, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen seien, wieder abzuschieben. Als Individuen tauchen diese Flüchtlinge im ganzen Roman nicht auf. Sie bleiben – nach dem rassistischen Prinzip der kollektiven Dämonisierung – eine anonyme, feindliche Masse. Spätestens mit diesem Schluss erreicht Marons Roman ein fragwürdiges literarisches Niveau und nähert sich ihren ressentimentgeladenen publizistischen Äußerungen an, etwa der über „die eineinhalb oder zwei Millionen (so genau weiss es ja keiner) jungen Männer, die in den letzten drei Jahren eingewandert sind“[29].
Es ist nicht unpassend, dass Monika Maron sich die Nebelkrähe zum Wappentier erkoren hat. Bildet doch für deren Population die Elbe eine Grenze wie einst für den Ostblock. Marons jüngste Sammlung von Essays aus drei Jahrzehnten unter dem Titel Krumme Gestalten, vom Wind gebissen ist im Verlag des Buchhauses Loschwitz in Dresden erschienen, das sich in den vergangenen Jahren zum Begegnungszentrum der rechtsintellektuellen Szene des Ostens entwickelt hat. Maron hat die Essays, in denen sie sich früher kritisch mit der ostdeutschen Mentalität beschäftigt hatte, in den neuen Sammelband nicht mehr aufgenommen. Gerade mit dem abstoßendsten Teil der neuerdings propagierten „Ostidentität“, der nationalistischen Borniertheit, scheint sie im Alter ihren Frieden gemacht zu haben. Sie hat ihre „Zonophobie“[30] überwunden – doch nur, um sich nun mit Stolz zu einer Angst vor dem Islam zu bekennen, die leider oft dem Hass ähnelt.
[1] Monika Maron: Pegida ist keine Krankheit, Pegida ist das Symptom. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article135973630/Pegida-ist-keine-Krankheit-Pegida-ist-das-Symptom.html, 4.1. 2015.
[2] Ebenda.
[3] Ebenda.
[4] Monika Maron: Das neue Elend der Intellektuellen. In: Zwei Brüder. Gedanken zur Einheit 1989–2009. Mit Fotografien von Jonas Maron. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2010, S. 43–55, hier S. 54 [zuerst in: taz, 6.2. 1990].
[5] Monika Maron: Warum bin ich selbst gegangen? In: Zwei Brüder, S. 33–39, hier S. 38 [zuerst in: Der Spiegel, 14.8. 1989].
[6] Maron: Pegida ist keine Krankheit.
[7] Monika Maron: Rede zum Lessing-Preis 2011 des Freistaates Sachsen. In: Krumme Gestalten, vom Wind gebissen. Essays aus drei Jahrzehnten. Dresden: edition buchhaus loschwitz, 2020, S. 81–91, hier S. 89f.
[8] Maron: Unser galliges Gelächter. In: Krumme Gestalten, vom Wind gebissen. Essays aus drei Jahrzehnten. Dresden: edition buchhaus loschwitz, 2020, S. 101–108, hier S. 105 [zuerst in: NZZ, 7.11. 2019].
[9] Ebenda, S. 91.
[10] Vgl. Volker Weiß: Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes. Stuttgart: Klett-Cotta, 2017.
[11] Monika Maron: Links bin ich schon lange nicht mehr. https://www.nzz.ch/feuilleton/bundestagswahl-links-bin-ich-schon-lange-nicht-mehr-ld.1303513, 30.6. 2017.
[12] Maron: Unser galliges Gelächter, S. 107. Das „Gefühl“ taucht noch vielfach auch in anderen Beiträgen Marons zum Thema auf.
[13] Monika Maron: Im Osten nichts als Opfer? In: quer über die gleise. Artikel, Essays, Zwischenrufe. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2000, S. 131–138, hier S. 137 [zuerst in: Berliner Zeitung, Mai 1998].
[14] Monika Maron: Rede zum Hölderlin-Preis. In: Zwei Brüder, S. 187–195, hier S. 188.
[15] Ebenda, S. 190.
[16] Ebenda, S. 194f.
[17] Vgl. Ralf Dahrendorf: Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. München: Piper, 1965.
[18] Monika Maron: Ich war ein antifaschistisches Kind. In: Zwei Brüder, S. 7–29, hier S. 7.
[19] Monika Maron: Genau die Kanzlerin, die die Deutschen woll(t)en. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article147213299/Genau-die-Kanzlerin-die-die-Deutschen-woll-t-en.html, 5.10. 2015.
[20] Maron: Links bin ich schon lange nicht mehr.
[21] Nie zweimal in denselben Fluss. Björn Höcke im Gespräch mit Sebastian Hennig. Mit einem Vorwort von Frank Böckelmann. Lüdinghausen und Berlin: Manuscriptum, 2. Aufl. 2018, S. 246.
[22] Sahra Wagenknecht: Couragiert gegen den Strom. Über Goethe, die Macht und die Zukunft. Nachgefragt und aufgezeichnet von Florian Rötzer. Frankfurt am Main: Westend, 2017, S. 156.
[23] Monika Maron: Munin oder Chaos im Kopf. Roman. Frankfurt am Main: S. Fischer, 4. Aufl. 2018.
[24] Ebenda, S. 188.
[25] Vgl. Botho Strauß: Anschwellender Bocksgesang. In: Heimo Schwilk, Ulrich Schacht (Hg.): Die selbstbewusste Nation. „Anschwellender Bocksgesang“ und weitere Beiträge zu einer deutschen Debatte. Frankfurt am Main: Ullstein, 3., erw. Aufl. 1995 [zuerst 1994], S. 19–40 [zuerst in: Der Spiegel, 8.2. 1993].
[26] Julia Encke, Neuer Roman von Monika Maron, Die Angst in ihrem Kopf, FAZ, 10.03.2018 https://www.faz.net/-gr0-97ycu
[27] Maron: Munin, S. 161.
[28] Maron: Munin, S. 207.
[29] Maron: Links bin ich schon lange nicht mehr.
[30] Vgl. Maron: Zonophobie. In: Zwei Brüder, S. 79–89.