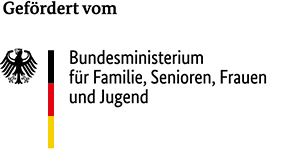Wieviel romantisches Ressentiment steckt in Hannah Arendts Büchern?

Die 1992 verstorbene jüdisch-amerikanische Philosophin Judith Shklar blickte zeitlebens mit Respekt und Skepsis auf das Werk ihrer großen Vorgängerin. Jetzt sind ihre Texte endlich auch auf Deutsch erschienen.
Seit einigen Jahren wird in Deutschland die 1992 verstorbene jüdisch-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Philosophin Judith Shklar entdeckt, die dem Nachdenken über eine offene, liberale Gesellschaft neue, unverbrauchte Impulse verliehen hatte. Erinnert sei etwa an ihr im Umbruchsjahr 1989 erschienenes Buch „Liberalismus der Furcht“, das statt hehrer Utopien ein praktikables Minimalprogramm physischer Leidvermeidung beschrieb, ein durch Institutionen gefördertes und geschütztes Respektverhalten. Nun sind ihre im Lauf von drei Jahrzehnten veröffentlichen Essays zum Leben und Werk von Hannah Arendt erschienen, erneut übersetzt und geistesgeschichtlich kundig kommentiert von Hannes Bajohr.
Auch sie bergen Überraschendes und Unkonventionelles, denn Shklar, geboren 1928 in Riga und mit ihrer Familie Stalinismus und Holocaust nur knapp entronnen, wirft ihrer berühmten älteren Kollegin nichts weniger als „Romantizismus“ vor. Shklar war seit den fünfziger Jahren immer wieder auf Hannah Arendt getroffen, deren Werk sie bestens kannte. Ihr Respekt für die drei Jahrzehnte ältere Kollegin blieb ungebrochen, doch bei aller Zuneigung stellte sich irgendwann die Frage, ob Arendts Hauptwerk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ wirklich als Augenöffner über den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts gelten konnte. Wenn Hannah Arendt zum Beispiel von „Massen“ schreibt, die sich Hitler oder Stalin unterordneten, wittert Judith Shklar eine höchst fragwürdige, da apolitische Denkfigur. „Im romantischen Denken sind der Durchschnittsmensch und der Philister immer mehr oder weniger identisch gewesen. Heute werden die Massen als die neuen Philister identifiziert. Daher spricht Hannah Arendt von der totalitären Gesellschaft als ‚Massen koordinierter Spießer´, die aus allen Ecken der Gesellschaft zusammengekommen seien…Was aber ist die soziale Bedeutung dieser Massen, einmal abgesehen von ihrer ‚Durchschnittlichkeit‚ und dem Mangel an ästhetischem Empfinden? Sie gibt keine annähernd abschließenden Antworten. Das ist freilich völlig natürlich, weil die Situation des Menschen für den Romantiker nie primär sozial ist.“
Ein harter Vorwurf, der allerdings ernst genommen werden sollte – nicht zuletzt mit Blick auf eine beunruhigende Gegenwart, in der es nun die sogenannte „moderne Massendemokratie“ ist, die für allerlei Übel verantwortlich gemacht wird. Es ist deshalb mehr als nur eine Ironie der Geistesgeschichte, dass ausgerechnet Hannah Arendt, die Philosophin der individuellen Verantwortlichkeit, bei ihrer Kritik des Totalitarismus in die bedenkliche Nähe eines elitären Naserümpfens gekommen war, für das womöglich ihr einstiger Lehrer Martin Heidegger Pate gestanden hat. Ohne jegliche Häme arbeitet Judith Shklar die Unterströmungen zwischen Heideggers Moderne-Verdammung (die nicht zuletzt eine Relativierung der NS-Verbrechen bedeutete) und Arendts herablassenden Blick auf die „Massen“ heraus. Ein Denken, das sowohl von deutscher Romantik wie auch vom Marxismus geprägt war: „Hannah Arendt ist der Meinung, die Zerstörung der Nationalgemeinschaften sei eine wesentliche Voraussetzung für den totalitären Massenstaat gewesen. Im Ganzen gesehen ist das aber lediglich eine Wiederholung jenes Rufs nach den ‚Wurzeln‚, den schon die Romantiker des 19. Jahrhunderts ausstießen…Die Identifikation der Massen mit Irrationalität ist dabei vor allem bei jenen beliebt, die darunter leiden, dass Marx tot ist. Für sie ist die Schlechtigkeit der Massen zumindest eine Erklärung für den Erfolg des Totalitarismus und das Versagen des Sozialismus. Alles, was dem unglücklichen Bewusstsein dann bleibt, ist, die eigene Integrität gegen die Übergriffe einer feindlichen Welt zu bewahren.“
Klingt dies nicht verblüffend aktuell in einer Zeit, da ganze Wählerschichten resignativ abgeschrieben werden und statt emanzipatorischem Überzeugungs-Élan eine antiglobal getrimmte, post-biedermeierliche „Achtsamkeit“ (zuvörderst gegenüber einem selbst) das fragil gewordene Gemeinwesen bewahren soll? Man reibt sich die Augen, denn Judith Shklar hatte diese Zeilen bereits 1957 geschrieben, da war sie gerade einmal 29 Jahre alt. Gerade aufgrund ihrer Wertschätzung für Leben und Werk Hannah Arendts fühlte sich Shklar über die Jahrzehnte hinweg immer wieder von jener Haltung provoziert, die sie als „Romantik der Niederlage“ bezeichnete und in scharfen Kontrast setzte zu einem konkreten, alltagstauglicheren liberalen Denken und Handeln: „Das Grundproblem des Liberalismus ist die Schaffung einer aufgeklärten öffentlichen Meinung, um die Bürgerrechte Einzelner zu schützen und die spontanen ordnenden Kräfte in der Gesellschaft zu ermutigen. Währenddessen machen die Romantiker aus der Selbstdarstellung eine Tugend und halten Individualität lediglich für notwendig in Opposition zu vorherrschenden Gesellschaftsstandards.“
Eine vergleichbar romantisierende Sicht diagnostiziert Shklar übrigens auch in Hannah Arendts geradezu schwärmerischem Schreiben über die athenische Demokratie und die amerikanische Revolution von 1776. In beiden Fällen würde die Existenz der Sklaverei genauso ignoriert wie die Tatsache himmelschreiender sozialer Unterschiede und politischer Interessenkämpfe. Woher aber kam diese Distanziertheit, diese blinden Flecke in der Wahrnehmung? Mit feinem Gespür arbeitet Shklar ein bislang kaum thematisiertes Dilemma heraus: Arendt, so ihre plausible These, stand nicht etwa aus Snobismus (oder gar Rassismus) sozialen Themen eher fern, sondern aus einer biographisch erklärbaren Scheu vor Gruppenstrukturen. Exilantin in den USA, hatte sie dort sogar zu den Organisationen der amerikanischen Juden beträchtliche Distanz gehalten. Überdies hatte sie in ihrem höchst kontrovers aufgenommenen Buch über den Jerusalemer Prozess gegen den Holocaust-Organisator Adolf Eichmann jegliche Einfühlung in die komplexe Lebenswelt des osteuropäischen Judentums vermissen lassen.
„In Arendts harschen Urteilen steckte ein gehöriges Maß an Stolz. Es war die bewusste Ablehnung, das passive, bedauernswerte Opfer zu spielen. Als Ausdruck politischer Strenge und eines andauernden Hasses auf das Mitleid geschah das ganz im Rahmen preußischer Sitten. Arendt kam auf dieses Motiv wieder und wieder zurück, oft zu ihrem eigenen Schaden oder zum Schaden anderer.“
Ergo eine im preußischen Zwangskorsett steckende, modernefeindliche und vom Marxismus enttäuschte Romantikerin, die mit ihrem fragwürdigen Mentor Martin Heidegger auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch so manches Stereotyp teilte? Nein, so weit geht Judith Shklar nicht. Denn keine aus Konkurrenzgründen geschriebenen Abrechnungen und Polemiken sind ihre Texte, sondern konkrete Nachfragen, die sich gleichermaßen aus der Sorge um das Schicksal der Demokratie und aus Sympathie für Arendts Lebenswerk speisen. Und deshalb geradezu liebevoll ihre persönliche Erinnerung an eine Denkerin, der sie selbst Maßgebliches verdankt: „Ihre Strenge war für die nach Autorität hungernden amerikanischen Studenten von großem Reiz. Darüber hinaus verstanden sie, dass Arendts Bildung eine Tiefe besaß wie es der education der Amerikaner niemals möglich sein würde. Niemand, der ihre Vorlesungen in jenem krächzenden, guttural ostpreußischen und deutsch betonten Englisch gehört hat, wird je diese Stimme vergessen können. Stets war sie eine überragende Erscheinung.“ Selten wurde mit größerer Fairness und begründeter Skepsis über eine Philosophin geschrieben, die – nach Jahrzehnten der Missachtung durch Vertreter der Frankfurter Schule – in den letzten Jahren beinahe in den Rang einer säkularen Heiligen gehoben worden war. Judith Shklars luzide Texte stellen jedoch nicht nur die Verhältnismäßigkeit im Fall Hannah Arendt wieder her, sondern schärfen auch den Blick für jene heutigen Politikanalysen, in denen mitunter ebenfalls eine ganze Menge enttäuschter Romantik wabert.
Judith Shklar: Über Hannah Arendt. Aus dem Amerikanischen übersetzt, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Hannes Bajohr. Matthes & Seitz, Berlin 2020. 189 S., brosch., Euro 14,-