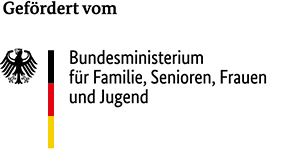Ernst Jünger und Joseph Wulf: Was nicht gesagt wurde

Die Brieffreundschaft zwischen Ernst Jünger und Joseph Wulf gehört zu den ungewöhnlicheren Schriftverkehren der Nachkriegszeit. Der nun verlegte Briefwechsel ist nicht nur eine wichtige Quelle zur Geschichte der Bundesrepublik der 1960er und 1970er Jahre, er trägt auch zum Verständnis des „Konservativen Revolutionärs“ Jünger bei.
Die Brieffreundschaft zwischen dem Vordenker der Konservativen Revolution und völkisch-nationalistischen Schriftsteller Ernst Jünger und dem jüdischen Auschwitz-Überlebenden und Pionier der historischen Erforschung der Shoah, Joseph Wulf, gehört zu den ungewöhnlicheren Schriftverkehren der Nachkriegszeit. In der Wulf-Biographik durchaus bekannt, hat der Briefwechsel in der Jünger-Forschung keinen großen Eindruck hinterlassen. Deswegen ist es umso erfreulicher, dass der Schriftverkehr jetzt in einer eigenen Edition vorliegt. Der folgende Beitrag stellt einige Überlegungen zum Umgang von Ernst Jünger mit Joseph Wulf an, und stellt die Frage, was sich aus der Auseinandersetzung der beiden über Jünger ablesen lässt.
Zur Entstehung lässt sich sagen, dass der Kontakt von Wulf gesucht wurde. Wulf verehrte Jüngers literarisches Werk und meinte in dem aristokratisch-faschistischen Schriftsteller einen aufrechten und, wie er häufig schreibt, souveränen Mann vorzufinden, der seiner politischen Gesinnung zum Trotz sich nicht dem Nationalsozialismus angeschlossen hatte. Wulf war der Überzeugung, dass dies aufgrund der charakterlichen Stärke Jüngers der Fall gewesen sei. Die Gründe, warum Jünger sich trotz seiner deutlichen Sympathien für den Nationalsozialismus diesem dann doch nicht anschloss, hinterfragt Wulf nicht. Die Verehrung des Schaffens Jüngers übertrug sich auch auf dessen Person, wie aus dem Briefwechsel verschiedentlich hervorgeht. Angesichts des Textanteils lässt sich vermuten, dass Wulf mehr am Kontakt zu Jünger lag, als umgekehrt. Während Wulf ausführlich und relativ lange Briefe schreibt, die von Begeisterung und Hochachtung vor Jünger nur so strotzen, fallen Jüngers Antworten hingegen knapp und sachlich aus. Wulf redet Jünger immer wieder mit „lieber, verehrter Herr Jünger“ an, umgekehrt spricht Jünger ihn nur mit „lieber Herr Wulf“ an. Zwar bekundet er immer wieder Interesse an der Arbeit Wulfs, die eine geschichtswissenschaftliche Pionierleistung auf dem Feld der Erforschung der Vernichtung der europäischen Juden darstellt. Die Arbeiten Wulfs sind umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass er diese als Privatgelehrter leistete und nicht als Teil eines Institutes oder Lehrstuhls. Es finden sich keine ausführlicheren Äußerungen zu den Arbeiten oder Fragen seitens Jüngers, und wenn, dann will er wissen, was denn gegen Werner Best, den Vertreter Reinhard Heydrichs, „vorliege“.
Wulf stellt Jünger immer wieder Fragen zu dessen Einschätzungen, wie er beispielsweise über die Person Hitler nachdenke. Jünger antwortet lapidar, dass ihm zu Hitler nichts einfalle, und ihn die Ereignisse der Vergangenheit auch immer unwichtiger erschienen. Allerdings gesteht er Wulf zu, dass dieser das angesichts seiner Biographie und seines Berufs als „Dokumentator“ wohl anders sehe. Schreibt Wulf bestürzt, dass die Ohrfeige Beate Klarsfelds gegen Kurt Georg Kiesinger wohl mehr zur Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit beitragen würde als all seine Bücher, versteht Jünger auch dies als Reaktion des nicht-deutschen Juden, der keinen positiven Blick auf Deutschland haben könne. Während Wulf immer wieder versucht, die Aufarbeitung der Shoah als Universalie zu sichern, zieht sich Jünger auf sein Deutschsein zurück, das es ihm verbieten würde, beispielsweise das Verhalten der deutschen Generalität im Zweiten Weltkrieg kritisch zu betrachten. Mehr noch sei es sein soldatisches Selbstbild, das hier unreflektiert aus ihm spräche.
Es scheint, als ob Jünger jeden kritischen Impuls Wulfs abwehren müsse. Die Fragen, Anmerkungen und Anregungen, die Wulf anbringt, seien, so Jünger, in Briefform gar nicht zu behandeln. Er leugnet die Ereignisse nicht, redet sie nicht klein oder relativiert sie – er spricht gar nicht erst über sie. Zu Beginn des Briefwechsels versichert er Wulf, dass sie sich in der Beurteilung einig seien. Dabei bleibt es aber. Es gibt keine Ausführungen dazu, worüber man sich einig sei. Jünger erwähnt die Vernichtung der europäischen Juden mit keinem Wort. Liest man Jüngers Antworten auf die Briefe Wulfs und dessen herausfordernde Fragen, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Jünger der Auffassung ist, dass ihn das im Grunde alles gar nichts anginge. Jünger inszeniert sich in den Briefen als der souveräne Solitär, der weder im Fernsehen auftreten will, weil er das Medium verachte, noch Zeit habe, sich mit Hitler auseinanderzusetzen. Wulf selbst musste sich als einsamer Streiter wahrnehmen, erfuhr er doch kaum Unterstützung bei seiner Arbeit. Wulf erkannte wohl in der Rolle des Außenseiters eine Ähnlichkeit zwischen sich und Jünger.
Es ist an dieser Stelle zwar spekulativ, aber man könnte die These aufstellen, dass Jünger sich auf die Diskussion nicht einlässt, weil er seinen Teil dazu beigetragen hat, den intellektuellen Nährboden für den Untergang der Weimarer Republik mit zu bereiten, und damit dem Aufstieg des Nationalsozialismus geholfen hat, auch wenn er sich diesem nicht angeschlossen hatte. All dem geht Jünger immer wieder aus dem Weg. Stattdessen betont er, dass es viel wichtiger sei, dass die beiden sich im Menschlichen angenehm seien. Worin diese menschliche Nähe bestanden hat, geht aus den Briefen Jüngers nicht hervor. Schreibt Wulf aber beispielsweise über die Vernichtung seiner gesamten Familie in Auschwitz und angesichts dessen über die Freude, eine Enkelin zu haben, „eine lebendige Wulf“, geht Jünger mit keiner Silbe auf diese Stellen ein.
Jünger akzeptiert Wulfs divergierende Haltungen und respektiert, dass Wulf als Überlebender von Auschwitz anders auf die unmittelbare Vergangenheit blickt, als er, der Verfasser von antisemitischen Schriften und Denker des antiliberalen, autoritären Gemeinwesens. Mit Wulf ein Opfer dieses Denkens zu kennen, löst bei Jünger keine Reflexion oder deutlich selbstkritischen Äußerungen aus. Ganz im Sinne des Dezisionismus ist Wulf eben ein anderer souveräner Solitär, der dem eigenen fremd gegenübersteht, den man aber respektieren muss. Wulf musste aus seiner Recherche über die Kultur und Schriftsteller im „Dritten Reich“ wissen, welche Schriften Jünger verfasst hatte („Über Nationalismus und Judenfrage“), und in welchen Kontexten Jünger publizierte („Die Standarte“, „Arminius“, „Die Kommenden“, „Vormarsch – Blätter der nationalistischen Jugend“). Dass Jünger trotz seines unmissverständlich vorgetragenen Hasses auf die Demokratie und die liberale Moderne im Nationalsozialismus nicht mittat, sondern diesen als „zu flach“ ablehnte, musste für Wulf ausgereicht haben. Es stellt sich die Frage, ob Wulf bei all der Verehrung für Jünger entgangen ist, dass er es im Grunde mit einem Nationalsozialisten avant la lettre zu tun hatte, der sich elitär von der Bewegung absetzte, weil er dort mit seinem aristokratischen Selbstbild keinen rechten Anschluss finden konnte. Wulf, so fasst es sein Biograph Klaus Kempter zusammen, ließ sich von Jünger nicht nur blenden, er wollte sich auch blenden lassen. Wulf empfand es als schick, den streitbaren Literaten Jünger zu kennen. Mit diesem Umstand schockierte er immer wieder gerne seine linksliberalen Freunde.
Der Briefwechsel ist eine wichtige Quelle zur Geschichte der Bundesrepublik der 1960er und 1970er Jahre. Zum einen lässt sich an den Briefen Jüngers ablesen, in welcher Unbescholtenheit ein Vordenker des Nationalsozialismus in Deutschland leben konnte, und welche Verehrung ihm zuteilwurde. Wulf ist bei weitem nicht der einzige gewesen, der nach Wilfingen „pilgerte“, wo Jünger seinen Alterssitz hatte. Auf der anderen Seite wird an der Person deutlich, welchen Stand die Aufarbeitung der Vernichtung der europäischen Juden in Deutschland hatte. Es war lange Zeit die Arbeit von isolierten Einzelgängern wie Wulf.
Ernst Jünger – Joseph Wulf: Der Briefwechsel 1962–1974. Hrsg. von Anja Keith und Detlev Schöttker. Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M. 2019, 168 S., 29,80 Euro.