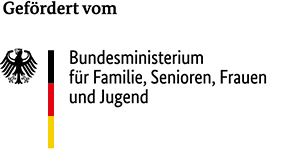Konferenzbericht: Neue Rechte, altes Denken

„Die liberale Demokratie und ihre Gegner“ – so lautete der Titel der Abschlusskonferenz des Projekts „Gegneranalyse“, die am 10. Oktober 2019 in Berlin stattfand. Im Zentrum stand die Frage: Was lernen wir aus der antiliberalen Ideengeschichte für die aktuelle Auseinandersetzung mit den Gegnern der Demokratie?
Ralf Fücks vom Zentrum Liberale Moderne begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz. Er wies auf den antisemitischen Anschlag vom Vortag auf die Synagoge in Halle hin, durch den das Thema der Konferenz drängende Aktualität gewonnen hatte. Auch wenn der Täter allein gehandelt habe, sei sein Denken in Netzwerken entstanden, die wieder an Stärke gewonnen hätten. Mit seinem Hass auf Juden, „Kanaken“ und Feministinnen vertrat der Attentäter ein Weltbild, das von rechtsextremen Ideologien dominiert ist. Das Projekt „Die liberale Demokratie und ihre Gegner – Gegneranalyse“ hat mit Essays zu antiliberalen Vordenkern und aktuellen Auseinandersetzungen versucht, dem antidemokratischen Denken analytisch näher zu kommen. Für die Konferenz ging es auch um die Frage, wie relevant eine solche ideologische Aufarbeitung für die Auseinandersetzung mit antiliberalen Kräften ist.

Die Konferenz begann mit einem Panel, das nach der Bedeutung der Auseinandersetzung mit den ideologischen Grundlagen antidemokratischen Denkens für die Arbeit von Multiplikator*innen in der politischen Bildung und Extremismusprävention fragte. Es diskutierten Thomas Krüger (Bundeszentrale für politische Bildung), Sanem Kleff (Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage) und Karl Weber (Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke e.V.). Sowohl dem Moderator Thomas Gill (Berliner Landeszentrale für politische Bildung) als auch den Diskutierenden lag zunächst daran, politische Bildung von der Extremismusprävention abzugrenzen. Ersteres betone die demokratischen Gestaltungsmöglichkeiten des Subjekts, letzteres nehme den Adressaten als potenziellen Gefährder wahr und messe den Erfolg politischer Bildung an sicherheitspolitischen Kriterien statt an der Mündigkeit des Individuums. Multiplikator*innen der schulischen und außerschulischen politischen Bildung sähen sich in den vergangenen Jahren zunehmend vor allem von rechts unter Druck gesetzt. Zum einen sei durch die Meldeportale der AfD eine große Verunsicherung hinsichtlich der im Beutelsbacher Konsens von 1976 als „Überwältigungsverbot“ festgehaltenen Neutralität von Multiplikator*innen ausgelöst worden. Sanem Kleff machte diesbezüglich klar, dass politische Bildung zwar in der Tat parteiunabhängig sein sollte, jedoch nicht wertneutral. Maßstab müsse die „Gleichwertigkeit der Menschen“ sein.
Karl Weber sah in parlamentarischen Anfragen der AfD, die die Träger der politischen Bildung betreffen, häufig „das inkarnierte Vorurteil“. Den intellektuellen Diskurs und die ideologischen Grundlagen zu kennen, sei deshalb wichtig, da die Neue Rechte nicht (nur) aus „Abgehängten“ bestünde. Er verwies weiterhin darauf, dass antidemokratische Akteure zumeist ein bestimmtes Bild von einer aggressiven heroischen Männlichkeit teilten. Die gezielten verbalen wie physischen Angriffe auf Multiplikator*innen nähmen zu, so Kleff.
Dies führte Gill zu der Frage, wie gut politische Bildung darauf vorbereitet sei und wo sich blinde Flecken befänden. Thomas Krüger sah einen möglichen Weg für die politische Bildung im Umgang mit neuen Herausforderungen darin, „über den professionellen Tellerrand“ zu schauen und mehr in informelle Bereiche beispielsweise über soziale Medien oder Influencer*innen hineinzuwirken. „Politische Bildung ist Teil der Lösung und des Problems“, meinte Krüger und forderte mehr Selbstkritik bezüglich der Wirksamkeit politischer Bildungsprozesse. Die Konfliktlinien liefen seiner Einschätzung nach heute weniger über ideologische Kontroversen als über unterschiedliche Kulturalisierungsprozesse, deshalb müsse die politische Bildung vermehrt auf Multiplikator*innen setzen, die dazwischen Brücken bauen könnten. Weber mochte die politische Bildung nicht als „Feuerwehr des Konsenses sondern als Wegbereiterin des kultivierten Streits“ verstanden wissen.
Welche Erfolgsrezepte hat politische Bildung im Umgang mit antidemokratischen Denkmuster und Handlungen? Weber nannte hier die Kooperation zwischen schulischen und außerschulischen Anbietern sowie aufsuchende Formate. Kleff berichtete, dass Kinder und Jugendliche an Schulen lernen könnten, wie sie sich gegen antidemokratische Ideen und Verhaltensweisen stark machen können. Krüger sah eine positive Entwicklung in der Öffnung in Richtung informeller Prozesse wie zum Beispiel neue Webvideo-Formate. Bedarf sah er bei der Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung. Gill fasste zusammen, das Podium habe aufgezeigt, mit welchen Fragen die politische Bildung im Kontext der „gesellschaftlichen Zuspitzungen“ konfrontiert sei. In der Diskussion mit dem Publikum beschrieb ein Konferenzteilnehmer seine Verunsicherung angesichts des verschwörungstheoretischen „Breis“, den Rechtsextreme wie auch der Attentäter von Halle am Abend verbreiten. Thomas Krüger antwortete, hinter dem vermeintlichen „Brei“ stünden klar benennbare rechtsextreme Konzepte und ideologische Grundlagen, deren langen Linien man bis mindestens in die 1920er Jahre zurückverfolgen könne. Und es sei gerade Ziel und das Besondere des Projekts „Gegneranalyse“, diese Denkmuster herauszuarbeiten.

Im zweiten Panel, das von Ann-Kathrin Büüsker moderiert wurde, ging es um die Geschichte und die Gegenwart antiliberalen Denkens – und um einen Blick über Deutschland hinaus. Zunächst widmete sich der Politikwissenschaftler Jens Hacke den zentralen Denkfiguren der antiliberalen Opposition in der Weimarer Republik. Immer, wenn es ungemütlich werde, so Hacke, sei hierzulande von „Weimarer Verhältnissen“ die Rede. Allerdings sei es wichtig, beim Verweis auf Parallelen zur Weimarer Republik auch die Unterschiede deutlich zu markieren. So gebe es heutzutage etwa keine Militarisierung, die Bundesrepublik sei vielmehr eine pazifistische und gefestigte Demokratie. Dennoch erlebten wir heute verschiedene Regressionsbewegungen, die an die Weimarer Zwischenkriegszeit erinnerten. Hacke nannte etwa einen starken Antiparlamentarismus bzw. die Ablehnung demokratischer Institutionen, den Nationalismus und das Streben nach völkischer Homogenität, aber auch eine pauschale Elitenkritik, außenpolitischen Revisionismus sowie einen antisemitisch grundierten Antikapitalismus.
Der Journalist Andreas Speit knüpfte daran an mit einer Ausführung zu gegenwärtigen Strömungen innerhalb der Neuen Rechten, die er als „Plagiat der Konservativen Revolution und des italienischen Faschismus“ bezeichnete. Die Theoriebildung in diesem Milieu sei weitestgehend abgeschlossen, selbst bei dem häufig als „neu“ rezipierten Konzept des Ethnopluralismus sei der Grundgedanke schon bei antiliberalen Vordenkern wie Carl Schmitt angelegt. Mit dem Rückgriff auf philosophische Autoritäten der Weimarer Zeit versuche die Neue Rechte, aus dem Schatten des Nationalsozialismus herauszutreten.
Der Journalist Jan Opielka verwies darauf, dass sich in der polnischen Gesellschaft bis heute bestimmte liberale Ideen nicht hätten durchsetzen können. Polen sei lange Zeit nicht unabhängig gewesen, weshalb der Kampf für Souveränität einen höheren Stellenwert besessen habe als der Kampf für den Liberalismus. Zudem werde der Begriff Liberalismus in Polen eher ökonomisch als Neoliberalismus verstanden und daher abgelehnt. Die regierende PiS sei so erfolgreich, weil sie den „Wendeverlierern“ nach dem Systemwechsel 1989 eine Kompensationsleistung geboten habe.
Claire Demesmay von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik knüpfte an die Ausführungen von Opielka an und sagte, dass auch in Frankreich der Begriff Liberalismus mittlerweile eher ökonomisch verstanden werde und „fast ein Schimpfwort“ sei. Sie beschrieb zwei Trends des antiliberalen Denkens: Zum einen hätten die islamistischen Anschläge seit 2015 in der französischen Gesellschaft zu mehr Akzeptant für die Einschränkung von Freiheiten geführt, was sich unter anderem in der großen Zustimmung zum Anti-Terror-Gesetz zeige. Zum anderen gebe es eine sehr verbreitete Elitenkritik und ein Misstrauen gegenüber Gewerkschaften, gleichzeitig aber ein immenses Vertrauen in Polizei und Militär. Demesmay plädierte dafür, auch die potenziell antiliberalen Elemente innerhalb des Liberalismus aufzuspüren.
In der anschließenden Diskussion unter den Podiumsgästen überwog eine stark ökonomistische Erklärung für den Erfolg der antiliberalen Revolte. Es wurde auf ungerechte Transformations- und Demütigungserfahrungen sowie die Zerstörung von Biografien in diesem Zusammenhang hingewiesen. Jan Opielka sagte, man könnte nicht über Antiliberalismus sprechen, ohne über den Kapitalismus zu reden. „Das Kapital braucht keine liberale Demokratie“, so Opielka. Gegen derlei Positionen gab es auch deutlichen Widerspruch aus dem Publikum. Er wundere sich, sagte ein junger Mann, dass nun wieder der Kapitalismus schuld sein solle und entgegnete Opielka: „Aber braucht die liberale Demokratie nicht die Marktwirtschaft?“

Ein Podium mit Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats widmete sich der Frage, welche Lehren aus dem Projekt gezogen werden können. Irina Scherbakowa vom russischen Menschenrechtszentrum „Memorial“ fragte, warum die Idee der Freiheit von 1989 keine visionäre Strahlkraft mehr entfalte. Eine Ursache sei, dass man Freiheiten ohne tiefere Auseinandersetzung einfach übernommen habe. Hinzu komme das kommunistische Sozialstaatsversprechen, das im realexistierenden Sozialismus zu Paternalismus verkommen sei. Und der sei auch heute noch überall ist Mittelosteuropa – auch in der Ex-DDR – als völlig Abhängigkeit der Menschen vom Staat spürbar. Russland sei heute nicht zufällig der Hort für Linkspopulisten und Rechtsextremisten von Venezuela bis Le Pen. Gemeinsamer Nenner sei die Degradierung von Menschenrechten und Individuum, die politische Instrumentalisierung von Gefühlen und lose Vorstellungen von Nationalstolz. Wladimir Putin und der regimenahe Ideologe Alexander Dugin seien Eklektiker – antimodern und postmodern im Sinne eines Postwahrheitsdiskurses zugleich. Aber es gebe auch Hoffnung: Während Demokratie und Liberalismus in den 1990ern in Russland geradezu Schimpfwörter gewesen seien, gehe heute die russische Jugend bei den Protesten zu den Lokalwahlen für Demokratie auf die Straßen.
Hedwig Richter vom Hamburger Institut für Sozialforschung warnte vor einem Krisendiskurs. Rechtsextremismus und Antisemitismus seien in den 50er und 60er Jahren viel verbreiteter gewesen. Umfragen zeigten, dass die Menschen heute zufriedener sind, denn je. Frauen hätten heute so viele Rechte wie noch nie. Die Mehrheit sei für Demokratie – auch im Osten. Und: Demokratie müsse nicht ständig wie der Rechtspopulismus Gefühle mobilisieren. Der Nationalismus sei im 19. Jahrhundert eine Antwort der Moderne auf Identitätsfragen gewesen, mit Demokratisierung einhergegangen und habe sich egalitär gegen die Ständegesellschaft gerichtet. Mit 1871 seien die regionalen Identitäten um eine gesamtdeutsche ergänzt worden. Das sei auch für Europa als Wertegemeinschaft denkbar.
Barbara Zehnpfennig, Professorin an der Universität Passau, warnte vor einfachen Erklärungsmustern für den Rechtspopulismus. Dieser antworte nicht auf soziale, sondern auf kulturelle Fragen. Kommunismus und Faschismus seien Antworten auf die bürgerliche Gesellschaft, die der Geburtsstunde des Liberalismus als seine Gegenbewegungen mit erwachsen sind. Die offene Flanke des Liberalismus sei die zu schwache geistige Ausgestaltung der Freiheit.
Ralf Fücks wies darauf hin, dass die Gegner der Demokratie mit starken Gefühlen agierten. Der Liberalismus lehne Gesellschaftsutopien geradezu ab. Fehlt ihm das affektive Moment? Zehnpfennig kritisierte, dass die Frage der Begründung der Freiheit privatisiert werde. Das führe zu einer Hyperindividualisierung, Narzissmus und gesellschaftlichem Auseinanderfallen. Gleichzeitig sei die rationale Diskussion über Werte keine Sache von Emotionen. Die ideengeschichtliche Auseinandersetzung mit dem antiliberalen Denken bleibe wichtig, so Zehnpfennig. Es gebe einen Kern wiedererkennbarer Argumente. Die Analyse müsse diese Kernelemente offenlegen. Denn die Psyche sei nur der Acker. Die Analyse der Ideen beschrieben das Saatgut, das Antrieb dafür sei, dass etwas Wirklichkeit wird.

Eine öffentliche Podiumsdiskussion am Abend widmete sich den Fragen der praktischen Politik: Was ist zu tun angesichts der antiliberalen Herausforderungen unserer Zeit? Diese Frage richtete Ralf Fücks an Oliver Schmolke (Bundespräsidialamt), Bettina Wiesmann (MdB), Manuela Rottmann (MdB) und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Friedrich-Naumann-Stiftung). Das hochkomplexe Problemfeld der aktuellen Entwicklungen wie die Globalisierungsprozesse, Handelskriege, Digitalisierung und die damit einhergehenden gravierenden Folgen für viele – darunter der massive Verlust an Arbeitsplätzen und existentieller Sicherung des Lebensunterhalts, aber auch an positiver Selbstidentifikation – zählten mit zu den Ursachen des beobachteten Antiliberalismus, so Bettina Wiesmann. Eine Vertrauensoffensive in die demokratische liberale Ordnung und der Versuch, Parteien zu rehabilitieren, könne erfolgreich sein durch mehr erlebbar gemachte Demokratie. Bei Kindern und Jugendlichen könne dies beispielsweise durch das Erlernen der demokratischen Beteiligung in Form von Jugendparlamenten oder dem Wettbewerb „Jugend debattiert“ gefördert werden.
Manuela Rottmann unterstrich das bei vielen Bürgern fehlende Gefühl der Selbstwirksamkeit. Hinzu kämen negative Erfahrungen, welche zur Enttäuschung über die Demokratie führten. Die staatlichen Institutionen, die die demokratische Ordnung repräsentierten, trügen laut Oliver Schmolke zur Rückbesinnung auf universelle Werte der liberalen Ordnung bei und stellten die Einheit des Gemeinwesens her. Die niemals an sich ideale freiheitliche Ordnung beinhalte einen inneren Widerspruch zwischen dem normativen Ideal und der Wirklichkeit; gerade dieser aber treibe die Gesellschaft zu den demokratischen Veränderungen an.
Eine erlebbare, funktionierende Demokratie, sei essenziell, so Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Sie müsse in Extremfällen wie Terrorakten sich gemeinsam und kraftvoll gegen ihre Gegner wehren, aber auch ein niedrigschwelliges Agieren und Engagement in verschiedensten Strukturen vom Ehrenamt bis zu Parteien ermöglichen. Die Freiheit solle keinesfalls als Hedonismus oder zügelloser Konsum aufgefasst werden, sondern – klassisch liberal – die Entfaltung jedes Einzelnen unabhängig von seinem sozialen Kontext ermöglichen. Emphatisches Einstehen der Politik für demokratische Werte und Kernbegriffe wie Menschenwürde sowie die Erfahrungen einer positiven Beteiligung an demokratischen Prozessen könne dem Einzelnen helfen, eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen antiliberale Reflexe zu entwickeln, die aus der unvermeidlichen Unvollkommenheit der demokratischen Ordnung resultieren.
Das Podium war sich einig darin, dass allein die soziale Frage oder eine Umverteilungsdebatte in der Auseinandersetzung mit (Rechts)Extremismus nicht ausreichend sei. Eine unermüdliche Arbeit auf Ebene der Bildung bis zur Parteipolitik und das positive Erlebnis von Demokratie könne die vorhandenen massiven „Modernisierungsschmerzen“ auffangen und das Vertrauen in die freiheitliche Ordnung stärken. Dazu gehöre, Vertrauen in staatliche Institutionen wieder herzustellen und individuelle Beteiligung an demokratischen Strukturen zu erleichtern. Jeder einzelne Kontakt zwischen Politikern und Bürgern sei hierbei entscheidend.
Hier können Sie die einzelnen Podien der Konferenz als Podcast nachhören und auch herunterladen:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen