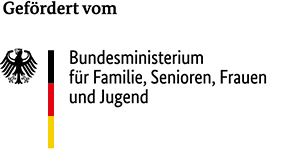Ostdeutschland: Wut schlägt Scham

Das „Wir sind das Volk“ der AfD als nachgeholter Widerstand gegen den SED-Staat.
Es ist eine erstaunliche Koinzidenz: Während die AfD mit „Vollende die Wende“ nicht „nur“ die friedliche Revolution für sich reklamiert, sondern mit der Revolutionsparole „Wir sind das Volk“ zugleich behauptet, für die gesamte DDR-Bevölkerung zu sprechen, versucht – stellvertretend für viele ähnlich agierende Medien – „Der Spiegel“ die ominöse „ostdeutsche Seele“ zu ergründen und kommt zu dem (sicherlich furchtbar ironisch gemeinten) Schluss: „So isser, der Ossi“.[1]
Eine Debatte, zwei Reaktionsmuster, die aber eines verbindet: Beide sehen die DDR-Bürger als eine homogene Masse – alle gleich. Doch die DDR war ein heterogenes Gebilde und eine gespaltene Gesellschaft, gespalten in Herrscher und Beherrschte – wobei die Trennlinien dazwischen alles andere als scharf waren. Es gab Spitzel und Bespitzelte, Parteisekretäre und Dissidenten, Karrieristen und Aussteiger. Und es gab viele verschiedene Milieus: kirchliche, künstlerische und intellektuelle Kreise, Arbeiter, Stadt und Land, den Partei- und Staatsapparat.
Im Jahr 1989 hatten die Mitglieder dieser gespaltenen Gesellschaft eine ungeklärte, fragile Identität. Die DDR-Identität war hinter der Mauer gleichsam stumm geblieben, hatte sich nicht im Vergleich mit dem Westen schärfen und artikulieren können. 1989 waren wir nicht mehr DDR-Bürger und noch nicht Bundesdeutsche, sondern Zwischenwesen. Nur ein Teil der DDR-Bürger fühlte sich wirklich noch mit der DDR identifiziert, ein anderer kleiner Teil fühlte sich bereits oder noch immer als „Deutsche“.
Dieser Tage wird daher oft behauptet, dass die ostdeutsche oder gar DDR-Identität überhaupt erst nach der Wende entstanden sei, durch die schwierigen, teilweise traumatischen Erfahrungen, die die Ostdeutschen im Vereinigungsprozess machen mussten. Meines Erachtens geht dies am Kern der Sache vorbei: Jeder, der in der DDR lebte, musste sich irgendwie zu diesem Staat in Bezug setzen, weil er zwangsläufig und immer mit ideologisch-hierarchischen Machtstrukturen konfrontiert war und dies hatte dann immer auch mit der eigenen Identität zu tun. Die Ostdeutschen teilten den gleichen Erfahrungsraum, in dem sie sich aber durchaus unterschiedlich verhielten.
Eines allerdings ist richtig: Der Vereinigungsprozess hat uns Ostdeutsche in einer Weise vereint, die die oben geschilderte Spaltung der Gesellschaft nur wenig berücksichtigt hat. Durch die schnelle Installierung der neuen Strukturen wurden die Spaltungen und Differenzen übertüncht. Egal ob Herrscher oder Beherrschter, Parteisekretär oder Bürgerrechtler – alle mussten sich mit den neuen westdeutschen Strukturen und der Infragestellung ihrer bisherigen Existenz auseinandersetzen. Alle bekamen vereint weniger Geld als Westler in vergleichbaren Positionen und wurden genauso „vereint“ als Diktaturgeschädigte gesehen. „Zwischen den früheren Stützen des Regimes und den notgedrungen Angepassten entsteht eine Eintracht, wie sie zu DDR-Zeiten nie existiert hat“, bilanzierte treffend Stefan Wolle.[2]
Zu der gemeinsamen sozial-ökonomischen Abwertung kam jedoch noch eine zweite, nicht weniger gravierende: Auch kulturell wurden die Ostdeutschen in der Bundesrepublik nicht begrüßt. Die Leistung ihrer Selbstbefreiung fand keine symbolische Würdigung. Es kam nicht zu einer neuen gemeinsamen Verfassung, es gab keine neue Fahne und auch nicht eine neue gemeinsame Nationalhymne. Und warum wurde nicht der 9. Oktober zum Feiertag der deutschen Einheit gemacht, der Tag des Friedensgebets in der Nikolaikirche, an dem 1989 in Leipzig die Menschen mit großem Mut in Massen demonstrierten und damit das Ende der DDR mit einläuteten? Der 3. Oktober als Tag der Einheit sagt dagegen nur etwas über den Verwaltungsakt des Beitritts aus, nichts aber, was sich irgendwie auch mit ostdeutscher Identität verbinden ließe.
Hinzu aber kommt ein Weiteres: Durch die schnelle Vereinigung, die die Mehrheit der Ostdeutschen in freier Entscheidung selbst gewählt hat, konnten die gravierenden Konflikte zwischen ihnen nicht ausgetragen werden, sondern wurden mehr oder weniger unter den Tisch gekehrt oder durch die rasante Installierung der neuen Strukturen weggebügelt. Für manche war und ist dies bis heute eine unverdiente Gnade, für andere Grund zu großer Bitterkeit. So kann es einem ehemaligen Häftling, der wegen Republikflucht einsaß, passieren, dass ihm sein ehemaliger Verhörer in der Berliner S‑Bahn gegenübersitzt – und dass er zusammen mit ihm zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Hauptbahnhof elegant über den ehemaligen Mauerstreifen fährt. Und falls sie beide inzwischen Rentner sind, kann man fast sicher sein, dass der einstige Verhörer eine höhere Rente bekommt als der Ex-Häftling.
Es gibt also massive, unaufgehobene Widersprüche aus DDR-Zeiten, die weiter wirken, Bitterkeit und Zorn erzeugen. Allerdings gehen viele Ex-DDR-Bürger der Auseinandersetzung mit ihrem psychischen und sozialen Geprägtsein durch die DDR bis heute aus dem Weg. Dies ist durchaus verständlich, weil sie nach 1989 extremen existenziellen Anforderungen ausgesetzt waren und zum Teil weiterhin sind. Die Ostdeutschen sind durch einen Systemwechsel gegangen, wie ihn die Menschen in der alten Bundesrepublik in den letzten 70 Jahren nie erlebt haben. 30 Jahre nach 1989 mehr oder weniger „angekommen“, fühlt sich die Hälfte der Ostdeutschen nach den neuesten Umfragen immer noch als Bürger zweiter Klasse.
Doch die Zeit seit 1989/90 erklärt beileibe nicht alles. Zudem, und vielleicht noch weit stärker, werden nämlich Selbstbewusstsein und Selbstverständnis aus dem eigenen Inneren angegriffen: wenn einem zunehmend bewusster wird, dass man in einer Diktatur gelebt hat, ihr ausgesetzt war und dies natürlich Spuren hinterlassen hat. Der narzisstischen Kränkung von außen auch noch eine eigene Verunsicherung von innen hinzuzufügen, stellt eine hohe Anforderung an Stabilität und Reflexionsvermögen dar, die nicht jeder aufbringen kann.
Darüber hinaus fühlen sich manche Ostdeutsche durch die Art des öffentlichen Umgangs mit ihrer Vergangenheit beschämt. Der Leipziger Psychoanalytiker Jochen Schade hat schon 2001 eine alte Scham benannt, „die doch entstehen sollte, wenn man sich verordneten Dummheiten unterwirft, sich bedingungslosen Redeverboten fügt und Demutsgesten vollbringt. Wer von uns kennt nicht die erfahrungsnahe, geradezu körperliche Registrierung peinigender Gefühle der Subalternität, die der öffentliche Alltag im Sozialismus so oft bereithielt?“[3] Diese alte, oft unbewusste und verdrängte Scham aus der DDR-Zeit, in der man sich Zwängen mehr als notwendig gebeugt hatte, wird jetzt in vielfältiger Weise ans Licht gezerrt. Und im grellen Licht der Öffentlichkeit und der Westscheinwerfer wird sie zu einer neuen Beschämung und zur Entwertung. Als ein Beispiel dafür kann der Umgang mit dem DDR-Antifaschismus dienen, der häufig als teilnahmsloser Antifaschismus gedeutet wurde. Doch die Sache ist weitaus komplizierter.
Willkommene Schuld-Entlastung
Die in der DDR nach 1945 in die Macht eingesetzten Politiker waren zum Teil erwiesenermaßen antifaschistisch oder reklamierten dies für sich. Sie schufen den Mythos, dass die DDR aus dem Antifaschismus geboren worden sei. Diese Saga entfaltete eine ungeheuer starke Wirkung – bis in die einzelne Familie hinein –, weil sie umfassende Schuldentlastung von den deutschen Verbrechen bot. Die Identifikation mit den Antifaschisten und später auch mit der DDR hatte den ungeheuren Vorteil, nun scheinbar auf der richtigen deutschen Seite zu stehen, auf der Seite des Widerstands und damit der Opfer. Wir sind die Guten, drüben sind die bösen Imperialisten. Diese Schuldentlastung wurde von den Deutschen Ost, die gar nicht unschuldiger waren als die Deutschen West, bereitwillig ergriffen und nach und nach sogar geglaubt.
Alles, was nach 1945 an psychischen Dispositionen, an Anfälligkeit für Unterordnung, an autoritärem Denken, Verachtung des Fremden und Schwachen weiter internalisiert war, wurde außer in der Kunst und Literatur nicht öffentlich bearbeitet. In den Institutionen und in den Familien gab es das gleiche Schweigen wie anfänglich im Westen. So wurde zugedeckt, was denn vor 1945 konkret an einer bestimmten Universität oder in einem bestimmten Krankenhaus oder in dieser oder jener Familie geschehen war.
Die ostdeutsche Großgruppe wurde von den russischen Siegern und ihren Erfüllungsgehilfen in Pankow bzw. Wandlitz in eine Ideologie gezwungen. Wenn man diese Ideologie, die anfangs mit wirklichem Terror, später mit Diktatur einherging, diesen Doppelknoten aus Sozialismus und Antifaschismus annahm, konnte man sich scheinbar von Schuld befreien und aus der deutschen Identität lösen. Konsequenterweise versuchte die DDR Anfang der 1970er Jahre, aus allen Bezeichnungen das Wort „deutsch“ zu entfernen: die deutsche Mark wurde zur Mark, die Strophe der DDR-Nationalhymne von Johannes R. Becher, die von „Deutschland einig Vaterland“ sprach, sollte nicht mehr im Wortlaut gesungen, sondern nur noch mit Instrumenten intoniert werden. Im September 1974 wurde mit einer Verfassungsänderung die deutsche Nation abgeschafft. Nun gab es die „sozialistische DDR-Nation“.
Mit der Aufpfropfung der Ideologie ging auch eine Zuteilung der Traumata und Ruhmesblätter einher. Sie wurden den Ostdeutschen von außen und oben zugeteilt, geboren auch aus der Lebensgeschichte ihrer in die Machtpositionen eingesetzten Führer wie Walter Ulbricht oder Erich Honecker, die beide in keiner Weise repräsentativ waren für die ostdeutsche Mehrheit. Ulbricht und Honecker kamen als Tischler und Dachdecker beide aus der Arbeiterklasse; sie waren schon vor 1933 Mitglieder der Kommunistischen Partei und dann im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und so hatten wir dann in der DDR nicht nur den 1. Mai, den Kampftag der Arbeiterklasse, oder den 8. Mai, den Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, sondern außerdem noch den Tag der Opfer des Faschismus am 11. September und natürlich den 7. Oktober, den Gründungstag der DDR, an dem die große Militärparade abgehalten wurde.
Dies waren aber nicht die Gedenk- oder Feiertage eines Großteils der DDR-Bevölkerung, etwa meiner Großeltern. Es waren die Tage ihrer Not und Verzweiflung, ihrer Niederlage und Scham. Denn sie waren wie die Mehrheit der DDR-Bürger nicht Opfer des Faschismus, sondern kleine Mitläufer gewesen, die unter der Vertreibung aus ihrer brandenburgischen Heimat, die jetzt in Polen liegt, sehr litten. Als Kaufmannsleute hatten meine Großeltern an den Kämpfen der Arbeiterklasse nie teilgenommen. Diese grandiosen Umdeutungen von Geschichte und Identität durch die russischen Sieger und die neuen Machthaber wurden von meinen Großeltern nur teilweise, von meinen Eltern und später von mir als einer Nachkriegsgeborenen allerdings schon stärker in die eigene Identität übernommen – und wir hatten uns dann an ihr abzuarbeiten.
Das Problem ist, dass diese aufgepfropfte Identität einerseits angenommen wurde, es andererseits aber immer eine andere Unterströmung von realen Erfahrungen gab: von Erfahrungen, die die Menschen in Krieg und Nachkrieg gemacht hatten und natürlich auch Erfahrungen mit der neu installierten Macht. Viele fühlten sich auf der benachteiligten deutschen Seite, in der DDR nicht am richtigen Platz. Immerhin haben von 1949 bis 1961 rund 2,7 Mio. Menschen die DDR, verlassen und nach dem Mauerbau noch rund 800 000.
Neben den offiziösen Geschichtsinterpretationen und ‑schilderungen gab es also immer erlebte wirkliche und manchmal erzählte Geschichten, die nur nirgendwo öffentlich artikuliert werden konnten. Ich kann mich noch sehr gut an die 1963 beim gemeinsamen Abwaschen hervorgepressten Sätze meiner Großmutter erinnern: Ich solle kein Wort glauben über die guten Russen, sie seien brutal und ungerecht gewesen nach dem Krieg. Und die Menschen trugen in sich neben den ihnen zugeteilten Traumen und Ruhmesblättern auch das Erlebnis neuer eigener Traumen und neuer eigener Heldengeschichten, die mit anderen geschichtlichen Daten verbunden sind: mit dem 17. Juni 1953, dem Jahr 1956, der Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn, dem Bau der Mauer am 13. August 1961, dem Jahr 1968 und schließlich der Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976.
Juni 1953 oder: Die Spaltung von Beginn an
Schon mit dem Volksaufstand am 17. Juni 1953, also ganz am Beginn der am 7. Oktober 1949 gegründeten DDR, war die Spaltung der DDR-Gesellschaft für alle sichtbar, durch die die Republik bis zu ihrem Ende gekennzeichnet war. Dabei ging es nur vordergründig um die Forderung, die von der Regierung verhängten zehnprozentigen Normerhöhungen zurückzunehmen. Dahinter standen ganz klar formulierte politische Forderungen, letztendlich nach Ablösung der SED-Herrschaft. In über 696 Ortschaften der DDR kam es zwischen dem 17. und 21. Juni zu Streiks oder andersartigen Protestaktionen, an denen 1 bis 1,5 Millionen Menschen teilnahmen. Die sowjetische Besatzungsmacht verhängte über 167 Land- und Stadtkreise den Ausnahmezustand und nur durch ihren Einsatz konnte die Macht der SED-Führer gesichert werden. Bei den Unruhen gab es auf Seiten der Demonstranten nach verschiedenen Quellen 50 bis 125 Tote.[4] Rund 7700 Personen wurden verhaftet und es gab nachfolgende Schauprozesse mit teilweise absurd konstruierten Urteilsbegründungen.[5]
Bis 1989 wurde in den Kaderakten erfasst, was jemand am 17. Juni 1953 gemacht, auf welcher Seite er gestanden hatte. Deutlich und brutal wie nie zeigte sich hier die Spaltung der Gesellschaft in die durch das Volk nicht legitimierten Herrscher und die Beherrschten. Nur die nackte Gewalt hatte die Herrschenden an der Macht halten können, die den Aufstand als einen Akt von Westprovokateuren und als faschistischen Putsch uminterpretierten. „Die Ereignisse im Juni 1953 waren für eine gesamte Generation ein Schlüsselerlebnis. [...] Das Datum nahm mythische Dimensionen an“, bilanzieren Achim Mitter und Stefan Wolle.[6] „Mentalitätsgeschichtlich grub sich ins kollektive Gedächtnis ein, dass jederzeit die SED mit allen Mitteln und vor allem mit Unterstützung der Besatzungsmacht jede oppositionelle Regung unterdrücken wird [...] und ihr ärgster Feind im eigenen Land steht: die Bevölkerung.“[7] Und wie immer kehrt die Geschichte eines Tages wieder: Im August 1989 fragte der Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, seine versammelten Stasi-Generäle in der großen Dienstbesprechung: „Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht?“[8]
Während 1953 somit für die Sichtbarkeit der Spaltung in der DDR steht, ist das Jahr 1968 der Punkt, an dem sich die beiden Teile Deutschlands erst richtig auseinanderentwickelt haben.[9] Dass die westdeutsche Alltagskultur im Jahr 1989 demokratischer, toleranter und weltoffener war als die der Ostdeutschen, haben die Westdeutschen zum einen ihren westlichen Besatzungsmächten und der durch Konrad Adenauer eingeleiteten Westintegration zu verdanken, zum anderen aber auch ihrer um 1968 rebellierenden Jugend. Die 68er stellten die nationalsozialistische Ideologie und die Überhöhung solcher Tugenden wie Ordnung, Fleiß und Gehorsam in Frage wie auch das nationale Deutschtum. Sie begannen, wie wir alle wissen, die Generationsauseinandersetzung mit den Eltern und in den Institutionen. Sie lebten das „ganz Andere“ in der Erziehung, in der Sexualität, im Hinterfragen der Geschlechterrollen. (Dass sie dabei oft überzogen agierten und ihre unbewusste Identifizierung mit den Täter-Eltern nicht klären konnten, steht auf einem anderen Blatt.)
Eine ähnliche Kulturrevolution hat es in der DDR nicht gegeben, weil sie mit allen zur Verfügung stehenden Repressionsmitteln unterdrückt wurde.[10] Obwohl dieser Geist in dieser Ostgeneration genauso zu finden war und über die Medien aller Art zu uns herüberschwappte, inspirierte er nur eine Minderheit, die ständigen Verfolgungen ausgesetzt war. Der DDR-Alltag war so bis zum Ende geprägt vom Fortwirken und der ständigen Neukonsolidierung autoritärer hierarchischer Strukturen und vom Versuch der einzelnen Bürger, sich damit irgendwie zu arrangieren.
Die falsche Opferidentifikation
Was die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus anbelangt, war diese in der DDR stark politökonomisch geprägt. Demnach führte der Kapitalismus getreu der Dimitroff-These quasi gesetzmäßig zum Faschismus. Es gab die Gedenkstätten in den ehemaligen Konzentrationslagern und die Gedenktage sowie die ständige Anforderung, ein „neuer“ Mensch zu werden. Die strukturellen Bedingungen für die Auflösung faschistoider Haltungen wurden aber nur teilweise geschaffen. In den Familien gab es oft das gleiche Schweigen darüber wie bis 1968 im Westen, was denn die Väter nun wirklich im Krieg getan oder nicht getan hatten. Dass DDR-Jugendliche erst in den 1980er Jahren anfingen, ihre Großeltern anders zu fragen, und viele unverdaute, geschönte Kriegserlebnisse zu hören bekamen, gehörte auch zu den Anfängen der rechtsradikalen Gruppen in der DDR.
Gedacht wurde in der DDR besonders der kommunistischen Opfer der Nationalsozialisten. So wurde am „Tag der Opfer des Faschismus“ auch an meiner Schule ein Fahnenappell abgehalten und das „Lied von den Moorsoldaten“ gesungen. Es ist ein berührendes Lied, von KZ-Insassen gedichtet und komponiert – der Wirkung auf die Seele konnte man sich nur schwer entziehen. „Hier in dieser öden Heide / ist das Lager aufgebaut / Wo wir fern von jeder Freude / hinter Stacheldraht verstaut.“ Refrain: „Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor ...“ Am liebsten hätte ich geweint; gleichzeitig bekam ich eine mir damals unerklärliche Gänsehaut. Auf einem DDR-Appell für DDR-Schüler gespielt, sollte das Lied das Mitgefühl und die Loyalität mit den Opfern des Faschismus mit der Bindung an den Staat DDR verknüpfen. Meine Gänsehaut sagte mir, dass etwas daran falsch war. Die DDR-Machthaber identifizierten sich mit diesen Opfern und benutzten die emotionale Ansprechbarkeit der Schüler für die Manipulation ihrer Gefühle. Nur sehr wenige der Anwesenden konnten dieses Lied aber mit Recht auf sich beziehen. Entweder waren sie zu jung, oder sie waren auch als Ostdeutsche eben gerade nicht „Moorsoldaten“, also Verfolgte oder Widerstandskämpfer gewesen.
Antifaschismus wurde so ein Teil der DDR-Staatsideologie und in dieser Verknüpfung zur Loyalitätsfalle. Manche bekamen bei diesen aufgezwungenen Ritualen und unter diesen Manipulationen kein Mitgefühl für die Opfer oder eine unerklärliche Gänsehaut, sondern einfach nur Wut. Sie wurden innerlich aggressiv gegenüber dem aufgepfropften Antifaschismus, durften dies aber unter Strafe nicht nach außen dringen lassen.
Staatskinder statt Staatsbürger
Auch noch auf andere Weise erschwerte das Erbe der DDR den Ostdeutschen, mündige Demokraten zu werden. Denn in der DDR wurde versucht, den Gegensatz zwischen Familie und Kultur einzuebnen, so wie das in Gesellschaften der Fall ist, die sich vom Kulturwandel abschirmen, indem sie die Adoleszenz, also die Zeit des Erwachsenwerdens, durch die Art der Initiation einfrieren.
Die Auswirkungen dieser Familiarisierung auf die Psyche der Bürgerinnen und Bürger der DDR hat Uwe Johnson schon 1970 in seinem hellsichtigen Essay „Versuch, eine Mentalität zu erklären“ beschrieben. Darin setzt er sich mit der Mentalität von Menschen auseinander, die aus der DDR in die Bundesrepublik gegangen waren. Ihm fällt auf, dass sie sich vom DDR-Staat auch nach dem Weggehen nur schwer trennen können: „So reden Kinder von ihren Eltern. So reden Erwachsene von jemand, der einst an ihnen Vaterstelle vertrat.“ Und er beobachtet: „In vielen Aussagen erscheint die DDR als fest umrissene personenähnliche Größe (während die Bundesrepublik bewusst ist als lediglich eine Lage, in der man sich befindet).“ In jener familiarisierten DDR-Kultur wurde dann ja wirklich von „unseren Menschen“ gesprochen, wie man von „unseren Kindern“ spricht, und es kam zu der jetzt so oft beschworenen „menschlichen Wärme“ im gesellschaftlichen Umgang, wie sie vielleicht eine solche familiarisierte Kultur hervorbringt – mit all ihren Vor- und Nachteilen.
Die Vorteile sind die Gefühle von Geborgenheit und Zusammengehörigkeit, die diese Kultur ihren Mitgliedern bietet: Man arbeitet für den Staat, und der Staat übernimmt fürsorgerische Funktionen für seine Bewohner. Wenn man sich aber gegen den Staat wendet, kann man sich dennoch seiner ständigen verfolgenden Aufmerksamkeit gewiss sein. Der Nachteil einer solchen familiarisierten Kultur ist, dass sie sich vor jeder Veränderung nach außen und nach innen abschirmt. Die DDR-Jugendlichen trafen bei ihren Versuchen, sich vom Elternhaus zu emanzipieren, auf eine Kultur, die sie erneut einbinden und auf sich kritiklos verpflichten wollte, sie sogar mit einer wirklichen Mauer einmauerte. Die DDR-Kultur ermöglichte somit wenig Generationsauseinandersetzung und keinen offenen Umgang mit gravierenden gesellschaftlichen Konflikten. Und sie schrieb sich als eine Art Elterninstanz in die Seelen ein, die man dann auch jederzeit anklagen, bewundern oder für sein eigenes Schicksal verantwortlich machen konnte.
Noch einmal lassen wir uns das nicht gefallen!
All dies beförderte besondere Verhaltensweisen. Besonders beliebt, ja ein geradezu weitverbreiteter Volkssport war es, die Gesetze des Staates mit klammheimlicher Freude hintenherum außer Kraft zu setzen oder zu umgehen, also nicht die offene Auseinandersetzung und den offenen Konflikt zu suchen, weil dies oft zu gefährlich war. 1989 wagten die DDR-Bürger dann den offenen Konflikt, und es ist wirklich tragisch, dass diese Leistung der Friedlichen Revolution bis heute nicht gebührend Anerkennung im vereinten Deutschland findet.
Mit den schnell installierten neuen Weststrukturen gingen einige Ostdeutsche nach 1990 nun zunächst um wie zu DDR-Zeiten: Sie versuchten nicht, sich in sie einzubringen und durch Mitwirken zu verändern, beziehungsweise sich auch gegen einige der neuen Zumutungen zu wehren. Sondern sie versuchten erneut, sie mit passivem Widerstand zu umgehen. Sie waren nicht geübt im konstruktiven Austragen von Konflikten in der Öffentlichkeit, hatten keine Streitkultur erlernt und verinnerlicht. Selbst die nach 1989 Geborenen sind teilweise noch durch diese Verhaltensmuster geprägt, und auch ihnen fällt die Generationsauseinandersetzung schwer, weil sie oft mit desorientierten und entwerteten Eltern konfrontiert waren.
Zudem steigen erst jetzt, nach Jahren und Jahrzehnten, bestimmte Gefühle aus DDR-Zeiten auf, können erst jetzt zugelassen werden, holen uns nun ein und werden nun am neuen und damit falschen Objekt abreagiert. So konnte ich erst beim Lesen meiner Stasi-Akte die Angst spüren, die ich eigentlich schon zu DDR-Zeiten hätte spüren sollen. Was hätten sie mit mir und meiner Familie machen können, wenn sie gewollt hätten? Und was haben sie manchen wirklich angetan! Nach der Lektüre hatte ich Angstträume, die ich aus DDR-Zeiten nicht kannte. Damals hatte ich es vorgezogen, die gegen mich und meine Familie gerichteten Maßnahmen kaum wahrzunehmen: Ich habe die Staatssicherheit nicht ernst genommen, das war mein Trick. Denn Angst hat niemand gern, weil sie klein und ohnmächtig macht. Sie ist aber ein gutes und beachtenswertes Signal. Eine Verdrängung von Angst kann zu Verharmlosungen führen und erleichtert bequeme Lebensarrangements.
Wird eine solche Angst heute in der Angst vor den Fremden nachgeholt? Gab es nicht auch nach 1990 eine „Fremdheit im eigenen Land“ durch neue Strukturen und die Mitglieder der Westeliten, die oft als die neuen Herrscher empfunden wurden? Wird die eigene Fremdheit in der neuen Kultur und das Sich-ihr-nicht-gewachsen-Fühlen auf die Migranten projiziert, bei ihnen verortet und dann dort verachtet und bekämpft?
Verschobener Aufstand gegen die Eliten
Fest steht: Das heute lautstark geäußerte Misstrauen in die Eliten überhaupt wäre gegenüber den DDR-Machthabern mehr als berechtigt gewesen. Ebenso könnte man den permanent benutzten Ausdruck „Lügenpresse“ auf die DDR-Presse anwenden: Wer sich noch erinnert, weiß, wie viel dort verschwiegen wurde, was alles beschönigt oder verzerrt dargestellt wurde. Auch hier wirkt es auf mich manchmal wie ein nachträgliches Abreagieren unter dem Motto: „Noch einmal lassen wir uns das nicht gefallen!“
Dass dieser Protest heute von rechts kommt, kann nicht sonderlich verwundern: Rechtes Gedankengut gab es auch in der DDR, es wirkte unter der Decke, wo sich Bitterkeit und Zorn über das „antifaschistische“ System, das als Herrschaftssystem installiert war, anstaute. Mit der schnellen Installation der Weststrukturen nach 1990 sind die Auseinandersetzungen über die Elterninstanz DDR und ihre Ideologie in Ostdeutschland weitgehend ausgeblieben; die Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit wurde primär innerhalb der neuen Weststrukturen angeschoben. So erlebten manche diese Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit nicht als ihre eigene Auseinandersetzung, sondern als eine angeblich westdeutsche Idee: eine installierte Beschämung, die nur dazu dienen sollte, die vermeintlich parallel stattfindende wirtschaftliche Enteignung des „Volkseigentums“, also auch „ihres“ Eigentums, zu verbrämen.
Sie merkten beim Verlust aller Koordinaten und der stattdessen oft nicht selbstbestimmten Übernahme der bundesrepublikanischen Strukturen, dass die DDR auf eine verquere Weise doch auch ihre Heimat gewesen war. Und es gibt bis heute Trauer und Zorn über die Verluste von Vertrautem und von Sicherheit, vor allem aber den Verlust von Arbeit – und über den Verlust der Utopie von 1989, doch „das Volk“ zu sein und direkt Einfluss nehmen zu können auf die Geschicke der Gesellschaft. Die gerade mühsam erworbene Mündigkeit im politischen Handeln ging bei manchen wieder verloren in dem Gefühl, sich in der gemeinsamen Bundesrepublik eher wieder ohnmächtig neuen Strukturen und Zwängen ausgeliefert zu sehen.
Die AfD als der Versuch, erneut ein Kollektiv zu bilden
Wie man sich in diese Demokratie einbringen kann, ohne aggressiv um sich zu schlagen – das ist die Frage, die die rechten Provokateure uns allen auf den Tisch legen. Die AfD ist dagegen der Versuch, erneut ein Kollektiv zu bilden: gegen Beschämungen und Entwertungen, die uns vermeintlich und zum Teil wirklich der Westen zugefügt hat. Nein, die AfD ist keine „Emanzipationsbewegung des Ostens“, wie das etwa Jana Hensel behauptet. Sie greift auf dumpfe Reflexe gegen die Fremden zurück und kämpft in einer Art nachgetragenem Ungehorsam gegen die Demokratie der Bundesrepublik, die die Flüchtlinge aufgenommen hat. Dass gerade diese Demokratie sie als Partei zulässt, ihre Aufmärsche, wenn nötig sogar mit Polizeigewalt, schützt, erreicht nicht den Horizont ihrer Mitglieder. Anscheinend ist ihnen auch nicht bewusst, dass sie mit ihrem Hass auf die andersartigen Flüchtlings-Menschen manchmal auch die Westler meinen.
Sich dagegen dem Schmerz des eigenen Versagens, der alten eigenen Scham zu stellen, und der damit verbundenen Trauer über verlorene oder verbogene Lebenszeit, ist dagegen die große Herausforderung – und wirklich schwer. Denn dies wäre auch ein sehr individueller Prozess, der die Brüche im ostdeutschen Kollektiv deutlich machen würde und für den man nicht so leicht einen Westler oder den Westen in Gänze verantwortlich machen könnte. Scham, Traurigkeit, Wut, aber auch Schuld sind nicht gleich verteilt im Osten. Es geht um eine individuelle Auseinandersetzung, die zur Individualisierung der ehemaligen DDR-Bürger führt.
Vielleicht liegt darin ja ein positiver Effekt der AfD-Erfolge. Jetzt ist die Zeit endgültig reif, dass die Ostdeutschen miteinander über ihre eigene Vergangenheit und ihre Verdrängungen streiten, als sich immer nur in Abwehrkämpfen gegen westliche Zuschreibungen zu verbünden.
Genau damit aber käme auch das ganze Land den entscheidenden Schritt weiter: Die Frage nach der ostdeutschen Identität könnte sich so zunehmend auflösen in der Frage, wie man heute als Deutscher zu Deutschland steht; ob es bald 75 Jahre nach Kriegsende und 30 Jahre nach dem Ende der Spaltung so etwas wie eine gute, das heißt eine positive gemeinsame deutsche Identität geben kann und wie diese beschaffen sein könnte. Dazu aber bedarf es des Raums und der konstruktiven Auseinandersetzung zwischen möglichst vielen unterschiedlichen Stimmen – aus Ost und West.
Der Text erschien zuerst im Heft 10 des Jahrgangs 2019 der Blätter für deutsche und internationale Politik.
Anmerkungen
[1] Vgl. den Aufmacher von: „Der Spiegel“, 24.8.2019.
[2] Stefan Wolle, Die heile Welt der Diktatur, Berlin 1999, S. 86.
[3] Jochen Schade, Wie gegenwärtig ist die Vergangenheit?, in: Werner Bohleber und Sibylle Drews, Die Gegenwart der Psychoanalyse – die Psychoanalyse der Gegenwart, Stuttgart 2001, S. 170.
[4] Die Sowjets zeichneten dabei für 18 standrechtliche Erschießungen verantwortlich.
[5] Vgl. den Beitrag von Ilka-Sascha Kowalczuk in: Hans-Joachim Veen u.a. (Hg.), Opposition und Widerstand in der SED-Diktatur, Berlin und München 2000.
[6] Achim Mitter und Stefan Wolle, Untergang auf Raten, München 1993, S. 161.
[7] Kowalczuk, a.a.O.
[8] Achim Mitter und Stefan Wolle, Ich liebe euch doch alle! Befehle und Lageberichte des MfS Januar–November 1989, Berlin 1990, S.125.
[9] Siehe dazu etwa Heinz Bude, Das Altern einer Generation, Frankfurt a. M. 1995.
[10] Annette Simon und Jan Faktor, Fremd im eigenen Land?, Gießen 2000.