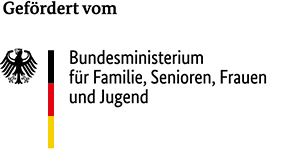Gewalt, Schmerz und Heroismus

Während allenthalben vom „postheroischen Zeitalter“ die Rede ist, huldigt das antiliberale Denken einem neuen Heroismus. Die Zivilisationsleistung der Befriedung der Gesellschaft gilt ihm als Frevel und Entfremdung vom ursprünglichen Sein. Der beschworene Heldenmut verbindet Gewaltbereitschaft mit Leidensfähigkeit – zwei Aspekte die Wiedersinngebung in einer sinnentleerten Moderne versprechen.
Die Kritik an der liberalen Moderne macht sich seit jeher auch an der Krise des Mannes fest. Beklagt wird der Verlust von Männlichkeit. Der modernen Gesellschaft wird vorgeworfen, sie verleugne die Natur des Mannes, in dem sie die ihm gegebene Aggression zu zügeln versuche. Zwar hätten mit Zivilisation, Rationalität und Technisierung das Leben bequemer, einfacher und sicherer werden lassen. Im Gegenzug seien aber Leidenschaft und Opferbereitschaft auf der Strecke geblieben. Der Mensch sei durch seine Zivilisierung der Naturverbundenheit beraubt worden. Verbindungen zur Natur seien gekappt, Instinkt, Triebe und Aggression aus dem gesellschaftlichen Raum verbannt worden.
Sowohl der Mann als auch die Gesellschaft seien durch Fortschritt, Komfort und zivilisierte Konventionen verweichlicht und verweiblicht, wenn nicht sogar entmannt worden. Es gebe keine echten Gefahren und Herausforderungen mehr. Einstige Tugenden wie Ritterlichkeit – die heldenhafte Verteidigung des „schwachen Weibs“ – sowie Ehre und Stolz – die es notfalls im Duell ebenfalls zu verteidigen gilt – hätten an Bedeutung verloren.
Im Ergebnis bedeute das moderne Leben nicht nur Naturentfremdung, sondern auch schlicht Langeweile. Das moderne Leben führe zu allgemeiner Verflachung, das zivilisierte Dasein sei zur Belanglosigkeit verdammt. Als Beleg für diese innerliche Leere des modernen Lebens werden typische Verdrängungstaten angeführt. Konsumismus und materiellen Streben gelten als – psychologisch gesprochen – Fehlleistungen, die das Gefühl der inneren Leere betäuben sollen.
Haltung statt Inhalt
Als Therapie gegen diesen bedauerten Zustand wird ein neues Heldentum empfohlen. Die Therapie behandelt jedoch nur die Symptomatik. Nur das, was wirklich Opfer oder gar Todesmut verlangt, genießt in diesem Denken die Weihen eines höheren Anspruchs und verspricht damit Sinnstiftung im sinnentleerten Dasein. Der Gegenstand, für den Opferbereitschaft verlangt wird, ist nicht entscheidend, oft auch austauschbar. Wichtiger als das „Wofür?“ ist eine bestimmte Haltung. Sie genügt bereits als Ausweis für einen höherstehenden Idealismus, ist man doch schließlich bereit, für eine Sache alles zu geben, notfalls das eigene Leben. Idealismus ist hier nicht mit der philosophischen Epoche des Deutschen Idealismus zu verwechseln. Es geht lediglich um eine inhaltlich nicht definierte Haltung: die Bereitschaft, alles Tun, Wollen und das Leben einer Idee unterzuordnen.
Übersteigerte Männlichkeit gegen die „weiblich-jüdische Moderne“
Die Moderne führte und führt zu gesellschaftlich tiefgreifenden Umwälzungen und stellt auch Geschlechteridentitäten in Frage. Dies führte in der Gegenreaktion zu übersteigerten Männlichkeitsbildern. Nach 1900 entstanden überzogene Vorstellungen von hyperviriler Männlichkeit als Widerstand gegen vermeintliche Bedrohungen durch eine Kultur der Moderne, die als ‚weiblich‘ und zugleich ‚jüdisch‘ angesehen wurde. Der Philosoph Otto Weiniger setzte in seinem Bestseller „Geschlecht und Charakter“ (1903) das Männliche mit dem „Arischen“ gleich. Seiner Darstellung nach wirke im Mann das Prinzip eines idealistischen Weltzugang. Er siedelte den Mann über der Frau an, die er mit dem Bild eines materialistischen, auf Genuss ausgerichteten Judentums identifizierte.
Ulrike Brunotte beschreibt anhand der Schriften des Psychologen Hans Blüher („Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft“, 1917/19), wie mit der Diskussion um Männlichkeit im frühen 20. Jahrhundert das Ideal vom „wilden Krieger“ und stammesgeschichtliche Initiationsriten an Bedeutung gewinnen und zu Männerbundmodellen führen, wie sie in der Wandervogelbewegung, aber auch in SA und SS zum Ausdruck kamen.
Kriegsbegeisterung bei Ernst Jünger: Der Mann als Krieger
Verdruss über die Verflachungen der Moderne ist möglicherweise einer der Gründe für die verbreitete Kriegsbegeisterung, die mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 einsetzt. Die Kriegsbegeisterung spiegelt ein seinerzeit verbreitetes Bedürfnis, sich endlich für eine höhere Sache echten Gefahren aussetzen und Opferbereitschaft beweisen zu können.
Der Essayist Ernst Jünger vertritt mit seinem Leben und Werk wie kein anderer die Huldigung des heldenhaften Wagnisses und der Todesverachtung. Er entfloh als Minderjähriger der Langeweile des Abiturs, um sich der französischen Fremdenlegion anzuschließen. Nachdem sein Vater ihn von dort zurückgeholt hatte, zog er 1914 als Kriegsfreiwilliger in den Ersten Weltkrieg. Irmela von der Lühe erkennt in Jüngers Kriegsessays („In Stahlgewittern“, 1920; „Der Kampf als inneres Erlebnis“, 1922) die Begeisterung für einen Krieg, der „befreit und erlöst aus einer ereignislosen und doch dekadenten, technisierten und doch monotonen Wirklichkeit; im Krieg wachen die Urkräfte des Menschen (vor allem des Mannes!) endlich wieder auf, er stiftet wahre Gemeinschaft, er aktiviert ein brachliegendes Triebleben.“ Gleichwohl ist Jünger vom Krieg auch desillusioniert. Technisierung, Stellungskrieg und Giftgaseinsatz degradieren den soldatischen Helden zum Kanonenfutter. Eine ritterliche Begegnung im Kampf Mann gegen Mann ist unmöglich geworden.
Jüngers Verachtung für bürgerliche Gefahrenabwehr und Konfliktscheu
Jünger verabscheut die moderne bürgerliche und demokratische Gesellschaft mit ihren Gleichheitsidealen und Sicherheitsdenken: „Welche Meinung man immer von dieser Welt der Krankenkassen, Versicherungen, pharmazeutischen Fabriken und Spezialisten haben möge: stärker ist jener, der auf alles verzichten kann“ („Der Waldgang“, 1951). In seinem Hauptwerk „Der Arbeiter“ (1932) entwirft Jünger die Vision eines autoritär-imperialen Staats, „der mit dem bürgerlichen Sicherheitsdenken, mit seinem Vernunft- und Moralverständnis aufgeräumt haben … wird. … Im ‚Arbeiter‘ kehrt der Mensch zu wahrem Abenteuer, zur Konfrontation mit den Gefahren zurück und eben darin folgt er den dämonischen Trieben seines Herzens und seiner Natur“, beschreibt Irmela von der Lühe Jüngers Großessay.
Martin Heidegger: mit heroischer Philosophie gegen die Sinnlosigkeit des Lebens
Mit „Sein und Zeit“ legt Martin Heidegger 1927 eine Existenzphilosophie vor, die der Erkenntnis über die Sinnlosigkeit des Lebens wagemutig ins Auge schaut. Er sieht die Menschen in ihrer alltäglichen Sorge, ihrem Besorgtsein und der Fürsorge ausweichen vor der unangenehmen Wahrheit, dass das Ziel eines jeden Lebens letztlich der Tod ist und es keinen Sinn für das Dasein gibt. Dieser Blick in den Abgrund ist die heroische Haltung, die er einfordert, und von der er glaubt, dass wir ohne sie unsere Existenz verwirken. Er beklagt die „Not der Notlosigkeit“ und fordert, mit „Entschlossenheit“ sich dem eigenen „Sein zum Tode“ zu stellen, es anzunehmen und vom „uneigentlichen“ ins „eigentliche“ Leben zu treten. Pierre Bourdieu charakterisiert Heideggers Denken als „heroische Philosophie der Verachtung des Todes“ („Die politische Ontologie Martin Heideggers“, 1975). In seiner heroischen Todesverachtung trifft sich Heidegger mit Jünger, dessen Essay „Der Arbeiter“ er als wichtiges Werk seiner Epoche lobte.
Carl Schmitt: Politik als Krieg, wider die Belanglosigkeit des Liberalismus
Der Staatsrechtler und „Kronjurist des Dritten Reichs“, Carl Schmitt, propagiert ein Politik- und Staatsverständnis, das er bezeichnenderweise in Begriffen des Kriegs beschrieb. Die Unterscheidung in Freund und Feind macht er zum Grundprinzip alles Politischen. Den Krieg sieht er gar als Höhepunkt des Politischen. Er kritisierte „alles liberale Pathos“, das sich gegen Gewalt und Unfreiheit wende („Begriff des Politischen“, 1927). Jens Hacke schreibt über Schmitt, er sehe „keinen Sinn für das von Kelsen und anderen betonte Verdienst der liberalen Demokratie: den sozialen Frieden zu sichern und Konflikte prozedural auszutragen. Aus Schmitts Sicht vermag es der Liberalismus hingegen nicht mehr, eine klare Unterscheidung von Krieg und Frieden zu treffen, und der eigentlich notwendige Kampf wird in Diskussion und Konkurrenz aufgelöst. … Das mochte Schmitt nur als zivilisatorische Verweichlichung verstehen.“
Leo Strauss beklagt die „kastrierte Moderne“
Auch heute wird an den Universitäten wieder Aggression und ungebändigte Männlichkeit verteidigt gegen ihre Einhegung durch moderne Zivilisation und die Kompromisskultur des demokratischen Liberalismus. Der Karlsruher Philosoph Peter Sloterdijk reaktivierte den Begriff des „Thymos“ für die politische Theorie. Bruno Quélennec hat beschrieben, wie der antike Thymos-Begriff in den 1920er Jahren im Umfeld der Konservativen Revolution für die moderne Philosophie wiederentdeckt wurde. Der Heidegger-Schüler Leo Strauss stieß auf die vergessene Denkfigur in seiner Auseinandersetzung mit Carl Schmitt. Strauss behauptet, die moderne politische Philosophie habe die kriegerische Moral zugunsten einer bürgerlichen Moral verdrängt. Vernunft habe die Leidenschaft bekämpft. Empfindungen wie Stolz, Ehre, Ehrgeiz, Heroismus, Tapferkeit und Hochsinnigkeit würden in der Welt der Bourgeoise nicht länger als Tugenden angesehen und durch farblose Wohlstandswahrung ersetzt. Der Thymos sei abgewertet worden. Strauss beschreibt eine „kastrierte Moderne“: Die moderne Gesellschaft ist entmannt.
Peter Sloterdijks wirbt für die Rehabilitierung „thymotischer Energien“
Sloterdijk griff den Thymos-Begriff in seinem Buch „Zorn und Zeit“ (2006) wieder auf. Er wirbt für eine Rehabilitierung „thymotischer Energien“ als wahre Triebfeder geschichtlicher Entwicklungen. Die formlose Mitte mit ihren Langweilern, den Unterhändler des Ausgleichs, ließe hingegen jede Weltidee vermissen. Dagegen gelte es, den Zorn als politische Kraft wieder ins Recht zu setzen. Gleichwohl distanziert sich Sloterdijk von Faschismus und Kommunismus, die er als fehlgeleitete Zornpolitik ansieht, weil sie vorrangig vom Ressentiment getrieben seien.
Marc Jongen: Wutbürger als thymotische Bewegung
Ebenso distanzierte sich Sloterdijk von seinem ehemaligen wissenschaftlichen Assistenten Marc Jongen, der den Begriff des „Thymos“ als politisches Ideal weiterträgt und inzwischen für die AfD im Bundestag sitzt. Der in Princeton lehrende Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller machte darauf aufmerksam, wie Jongen die Demonstrationen von PEGIDA als „thymotische Bewegung“ aufwertete. Nach Jongen habe Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wegen des Kalten Kriegs und des amerikanischen Schutzschirms die Bedeutung von Krieg, Polizei und kriegerischen Tugenden vergessen – das was die Griechen als „Thymos“ bezeichnet hätten. Deutschland sei thymotisch unterversorgt. In dieser Sichtweise Jongens wird der ressentimentgeladenen „Wutbürger“ als Rückkehr des Thymos philosophisch überhöht.
Ellen Kositza beklagt Männlichkeitsverlust
Die aktuelle Neue Rechte ventiliert Vorstellungen gesteigerter Männlichkeit, von militärischem Schneid, Zucht und Heroismus und kritisiert die Verweichlichung und Verweiblichung der modernen Gesellschaft. Wie in der Weimarer Zeit zeigt sich hierin eine Gegenbewegung zur Auflösung traditioneller Geschlechterrollen.
Für Ellen Kositza, selbst siebenfachen Mutter und Frau des einflussreichen neurechten Ideologen Götz Kubitschek, ist die Rückbesinnung auf traditionelle Geschlechterrollen ein zentrales Thema ihrer publizistischen Tätigkeit. Ihre Sicht beschreibt die Zeit-Redakteurin Mariam Lau wiefolgt: „Frauen und Männer sind [bei ihr] nicht gleich; es bedeutet etwas, dass Frauen Kinder kriegen können; das Aggressive, Kriegerische gehört zum Mannsein, hat nicht domestiziert zu werden. ‚Gender ohne Ende – was vom Manne übrig blieb‘ lautet der Titel ihres 2008 veröffentlichten ersten Buches.“
Kositza steht stellvertretend für eine Haltung der Neuen Rechten, die den vorgeblichen Verlust von Männlichkeit in der modernen Gesellschaft beklagt. 2016 schrieb sie in einer Kolumne: „Ich habe geschwiegen, als das Drogerieregal für Herrenkosmetik breiter als zwei Meter wurde. Ich habe geschwiegen, als rosa Herrenhemden Mode wurden. Ich habe sogar Männer mit Tragetuch verteidigt. Aber zu den derzeitigen Heerscharen von Männern mit Dutt kann ich nicht schweigen. Es muss raus: Ihr Modeopfer, ihr Lackäffchen, ihr Stutzer, ihr Schwimmärmelträger, ihr Stromlinienförmigen, ihr Grazien! Ihr seht vollkommen beknackt aus.“
Die Klage von Ellen Kositza erfolgt auf zwei Ebenen. Zum einen geht es um traditionelle Geschlechterrollen, deren Auflösung kritisiert wird. Zum anderen wird das Kriegerische als männliche Eigenschaft beschworen. Es geht also um Gewalt als gesellschaftlich legitimiertes Mittel der Konfliktlösung. Die Gewalt des Mannes als Krieger ist dabei nicht nötiges Übel, sondern zu bewahrende Wesensart. Sie soll gerade nicht domestiziert und durch gewaltfreie Konfliktlösung zivilisiert werden.
Gewaltbereitschaft als Brücke zur ursprünglichen Natur des Menschen
Selbst in der Populärkultur erfahren archaische Männlichkeit, Aggression und zornige Leidenschaft neue Begeisterung. Die zeigt sich nicht nur am enormen Erfolgen von Netflix-Serien wie „Games of Thrones“ oder „Outlander“, deren mittelalterlichen Inszenierung von Intrigen, Ehrverletzungen und blutigen Schädelspaltereien weltweit Millionen gleichsam abstoßen und faszinieren. Es gibt einen Bedarf an Stoffen, die rohe Gewalt als Ausweis von Leidenschaft zeigen.
Ins gleiche Horn stößt auch die Mittelalter-Band „Heilung“, die auf selbstgebauten Instrumenten schamanisch anmutenden Esoterik-Sound für die moderne Weltflucht vor der Zivilisation anbietet. Die Musiker sehen ihre Botschaft ganzheitlich, ihr Tun nicht auf das Musikalische beschränkt. Das Bandmitglied Kai-Uwe Faust sagt im Interview mit dem Deutschlandfunk, man wolle die Leute „an einen Punkt bringen, wo sie sich selber annehmen und ihr wahres Wesen akzeptieren. … Das ist ein Zustand, den man durch Meditation oder Trance erreichen kann.“ In ihren Konzerten gehe es darum, ein Tor zu öffnen. Die Band will zeigen, dass die Menschen der Bronzezeit nicht dem friedliebenden Ideal der Flower Power-Anhänger entsprächen: „Das sind halt Menschen gewesen, die haben eine Einstellung gehabt, die Mord absolut toleriert hat. Das ist heutzutage nicht mehr Usus. Wir morden nicht mehr. Du sollst nicht töten.“ Die Band zieht daraus Lehren auch für heute: „Gewaltbereitschaft ist ein Teil des Menschseins. Ganz viele Menschen, die spirituell arbeiten, neigen dazu, die Augen zu verschließen vor dem Schatten. Es ist unheimlich wichtig auch in der Lichtarbeit den Schatten anzuerkennen und zu umarmen, zu akzeptieren, zu sagen, ja, du bist da, du bist dunkel, du bist böse, ja, du hast die Fähigkeit zu töten. Wir alle haben die.“ Auch hier geht es darum, die Fäden des Menschen zur Natur und Ursprünglichkeit neu zu knüpfen. Gewalt gilt dabei als Brücke zum verloren geglaubten Wesenskern unserer selbst. Sie soll helfen, die zivilisatorische Entfremdung von der Natur und der eigenen Natur zu überwinden.
Triebhaftigkeit als Reflex auf die „Domestizierung“ des Menschen
Es scheint, als würde die zivilisatorische Leistung der Befriedung der Gesellschaft gleichzeitig eine Sehnsucht nach neuem Heldentum hervorrufen. Die Zähmung zerstörerischer Triebe, des Zorns und der Gewalt wird in diesem Denken als „Domestizierung“ abgewertet.
Antiliberalismus als männliche Domäne
Weil die liberale Moderne die traditionelle Rolle des Mannes in der Gesellschaft grundlegend verändert und in Frage gestellt hat, ist es kaum verwunderlich, dass der Antiliberalismus vorwiegend eine männliche Domaine ist – aber nicht nur, wie das Beispiel Ellen Kositza und das anderer antifeministischer Frauen aus der neurechten Bewegung zeigen. Männer haben in der Moderne etwas zu verlieren, nicht zuletzt ihre Selbstgewissheit. Die Wähler von Trump und AfD sind nicht ohne Grund überwiegend Männer.
Gewaltbereitschaft und Leidensfähigkeit zeichnen den Helden aus
Die Forderung nach einem neuen Heroismus hat zwei wesentliche Aspekte. Zum einen wird Gewalt als gesellschaftlich legitimierte Verhaltensweise rehabilitiert. Gewalt erfährt Aufwertung und Rechtfertigung. Es geht hierbei um die Überwindung der Entfremdung und Künstlichkeit der Moderne, um die Restitution der Affekte gegen unterkühlte Rationalität. Der Krieg „aktiviert ein brachliegendes Triebleben“. Ernst Jünger wollte das ausdrücklich positiv verstanden wissen, obwohl und gerade weil es „dämonisches Triebleben“ ist. Dahinter steht der Wunsch nach einer Rückkehr zur Natur und einer Wiederanbindung an Ursprünglichkeit. Der Zugang zu Ursprünglichkeit verspricht, wieder Eins zu werden mit dem größeren Ganzen, das als geheimes Zentrum ein mystisches Element darstellt.
Zum zweiten wirkt der Heroismus auf der Ebene des Leids. Wo Gewalt Teil des normalen gesellschaftlichen Umgangs ist, kann Schmerzvermeidung nicht länger sinnvoll leitendes Handlungsprinzip sein. Leid und Schmerz versprechen vielmehr eine Wiedersinngebung einer als sinnlos empfunden Moderne. Das Leben in der rationalisierten Moderne erscheint in diesem Denken nur noch als Dahinvegetieren, als Erfüllung einer inhaltlich entleerten Funktion. Wer aber für ein Sache bereit ist, Leid und Schmerz zu erdulden, der gibt dem eigenen Sein einen höheren Sinn.
Die Figur des Helden vereint die beiden Eigenschaften der Gewaltbereitschaft und Leidensfähigkeit in sich. Er scheut nicht den blutigen Kampf und ist gleichzeitig in der Lage, ohne Klage heldenhaft Schmerzen zu ertragen.
Wider das staatliche Gewaltmonopol
Die Legitimation von Gewalt im antiliberalen Denken könnte ein Grund dafür sein, dass in Teilen Gesellschaft, die für solches Denken zugänglich ist, die Gewalt rechtsextremer Gruppen mitunter nicht als Entgleisung empfunden und verurteil wird, solange die politische Intention der Gewalt den eigenen Ansichten nahe steht.
In der Legitimation von Gewalt, die der Heroismus in sich birgt, steckt gesellschaftliches Sprengpotenzial. Sie stellt das staatliche Gewaltmonopol in Frage und richtetet sich gegen den Rechtsstaat. An seine Stelle tritt das „Recht des Stärkeren“. Gerechtigkeit wird in die Rechtschaffenheit die Figur des Helden internalisiert, ist von seiner Integrität abhängig. Der Held wird zum Richter und Vollstrecker in einer Person. Bestenfalls folgt der Held bestimmten Überzeugungen oder einem moralischen Wertekanon. Er ist dabei jedoch einserseits beeinflussbar und andererseits nicht kontrollierbar. Seine Rechtschaffenheit ist nicht durch Verfahren, Gewaltenteilung oder andere Mechanismen von checks and balances sicherzustellen. Der Forderung nach neuem Heroismus ist mit Rechtsstaatlichkeit kaum vereinbar und mit der Gefahr von Willkür verbunden.
Ulrich Bröckling hat darauf hingewiesen, dass die Geschichten vom Helden als Problemanzeiger zu verstehen sind: „Sie sind ein Index dessen, was die Gesellschaft dem Einzelnen abverlangt. Auch wenn die heroischen Selbst- und Fremdinszenierungen das Gegenteil suggerieren, sind Helden eher ein Symptom der Krise als eine Instanz, die sie löst.“ (Ulrich Bröckling, Postheroische Helden, Suhrkamp Verlag, Berlin 2020, S. 17)